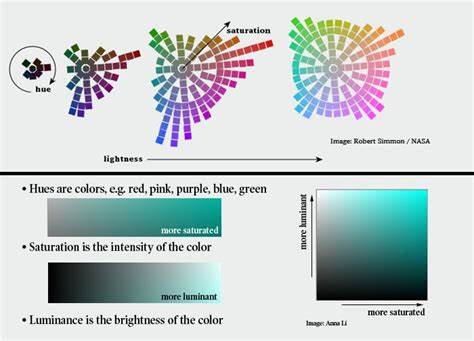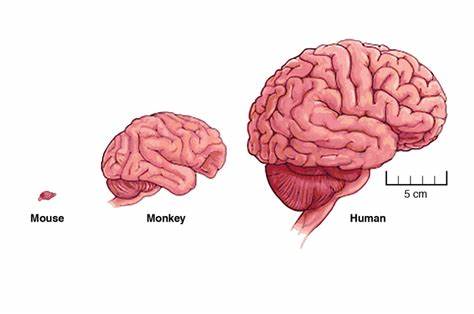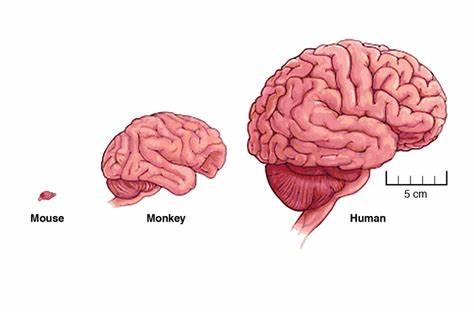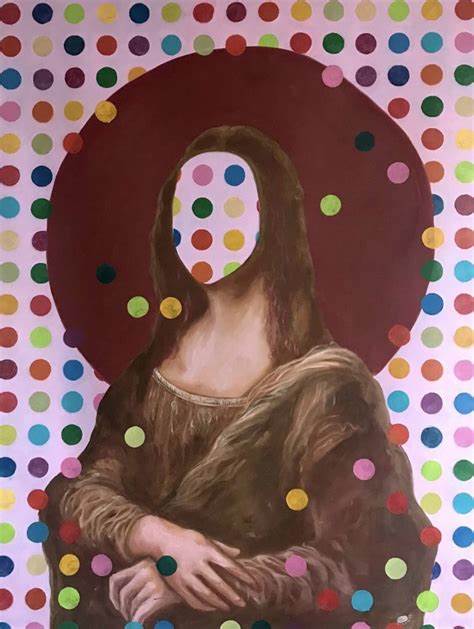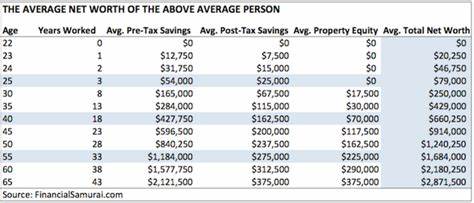Spotify sieht sich aktuell mit einem ernsten Problem konfrontiert: Auf der beliebten Audio-Streaming-Plattform wurden zahlreiche Podcasts entdeckt, die illegal verschreibungspflichtige Medikamente über Online-Apotheken zum Verkauf anbieten. Diese Fake-Podcasts sind nicht nur eine Herausforderung für die Sicherheits- und Moderationsmechanismen von Spotify, sondern stellen auch ein ernsthaftes Risiko für Konsumenten dar. Die Verfügbarkeit solcher Inhalte macht deutlich, wie schwierig es für Plattformen ist, zwischen legitimen und betrügerischen Angeboten zu unterscheiden und rechtzeitig einzugreifen. Das Problem wurde insbesondere durch eine Untersuchung von CNN ans Licht gebracht. Dabei wurde auf der Plattform nach Begriffen wie „Adderall“, einem häufig verschriebenen Medikament gegen ADHS, gesucht.
Neben seriösen Gesundheits- und Comedy-Podcasts tauchten plötzlich zahlreiche Fake-Angebote auf, die Nutzer direkt zu Onlineshops weiterleiteten, die teilweise illegale Verkäufe von Adderall sowie anderen stark regulierten Substanzen wie Oxycodon, Vicodin und Methadon propagierten. Diese Online-Apotheken versprachen sogar den Versand ohne gültiges Rezept – ein Verstoß gegen geltendes US-Recht. Spotify reagierte umgehend, nachdem CNN dem Streaming-Dienst eine Liste mit 26 Podcasts übermittelte, die solche illegalen Angebote promoteten. Innerhalb weniger Stunden wurden diese Podcasts entfernt. Allerdings zeigte sich, dass trotz des schnellen Eingreifens ähnliche Inhalte weiterhin auf der Plattform auftauchten.
Dieses Katz-und-Maus-Spiel demonstriert die Herausforderung, die das Unternehmen bei der dauerhaften Entfernung schädlicher Inhalte hat, zumal der Einsatz von KI-gestützten Text-zu-Sprache-Technologien es Betrügern erleichtert, große Mengen an Spam-Inhalten mit computergenerierten Stimmen zu produzieren. Die Werbung für illegale Medikamente auf einer etablierten Audio-Plattform wie Spotify bringt ernste Gefahren mit sich. Die leichten Zugänge zu vermeintlich verschreibungspflichtigen Medikamenten führen vor allem junge Menschen in die Irre und können tödliche Folgen haben. In den letzten Jahren gab es immer wieder Berichte über Überdosierungen von Medikamenten, die online ohne Rezept bestellt wurden. Daher wächst der Druck auf Tech-Unternehmen, rigoroser gegen solche illegalen Aktivitäten vorzugehen und damit die Nutzer besser zu schützen.
Spotify hat auf die Vorfälle hingewiesen, dass die Plattform klare Regeln für Inhalte hat. Diese verbieten unter anderem die Bewerbung illegaler Produkte und Spam. Der Streaming-Dienst nutzt sowohl automatisierte Systeme als auch menschliche Moderatoren, um gegen Verstöße vorzugehen. Dennoch zeigte sich, dass die Moderation in Bezug auf Podcasts, insbesondere solche mit computergenerierten Inhalten, einen „blinden Fleck“ aufweist. Die Sprachform macht es schwerer, Verstöße automatisiert zu erkennen und in kurzer Zeit zu entfernen.
Die Problematik von Spotify ist Teil eines größeren Trends, bei dem Plattformen mit nutzergenerierten Inhalten zunehmend Ziel von Tätern werden, die Online-Verkäufe von verschreibungspflichtigen und illegalen Medikamenten ankurbeln. Auch andere große Anbieter wie Google, Facebook und Twitter wurden in der Vergangenheit wegen ähnlicher Probleme kritisiert. Bei Google führte dies sogar zu einer milliardenschweren Geldstrafe, nachdem das Unternehmen Anzeigen für illegale Online-Apotheken schaltete. Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat zudem mehrfach Unternehmen aufgefordert, stärker gegen den illegalen Handel mit Opioiden und anderen Medikamenten vorzugehen. Das Grundproblem liegt allerdings darin, dass Internetplattformen aktuell weitgehend rechtlich geschützt sind, wenn Nutzer illegalen Content posten oder verbreiten.
Diese Regelungen erschweren die direkte Verantwortlichkeit von Plattformen und führen dazu, dass die Maßnahmen oft reaktiv und weniger effektiv wirken. Die fehlende Regulierung und klare Vorgaben für Plattformen lassen zudem Grauzonen offen, in denen Unternehmen wie Spotify operieren müssen. Besonders problematisch ist die Nutzung von Text-zu-Sprache-Technologie, mit der kleine, kurze Podcast-Folgen sehr einfach automatisiert erstellt werden können. Die Fake-Podcasts sind häufig sehr kurz, mit monotonen computergenerierten Stimmen, die potenzielle Kunden direkt ansprechen und auf Webseiten verlinken, auf denen angeblich lizenzierte Arzneimittel ohne Rezept verkauft werden. Die Beschreibungen nutzen medizinische Begriffe und versprechen schnelle, diskrete Lieferung mit „FDA-zugelassener“ Legalität, obwohl die Wirklichkeit häufig das komplette Gegenteil ist.
Analysen zeigen, dass bei Suchanfragen zu beliebten Medikamenten wie Adderall, Xanax, Valium oder Percocet oft ein erheblicher Teil der vorgeschlagenen Podcasts aus solchen Fake-Angeboten besteht. Nutzer, die sich über Medikamente informieren möchten, werden so ungewollt auf illegale und potenziell gefährliche Verkaufsseiten geführt. Dass die Podcasts meist keine Bewertungen oder Nutzerinteraktionen aufweisen, lässt vermuten, dass viele dieser Kanäle nur darauf ausgelegt sind, Lawinen an Content zu erzeugen, um Menschen zu ködern, ohne eine echte Community oder authentische Nutzerbasis zu haben. Spotify bemüht sich zwar, seine Regeln stetig zu verbessern und investiert in Tools und Expertenteams, die problematische Inhalte erkennen sollen. Nach Kritik bezüglich anderer Inhalte, wie etwa der umstrittenen Corona-Podcasts, hat Spotify eine Safety Advisory Council eingerichtet und mit Kinzen ein Unternehmen für maschinelles Lernen übernommen, das Audioinhalte auf Regelverstöße prüfen kann.
Dennoch zeigen die Fake-Podcast-Vorkommnisse, dass gerade im Bereich der Podcast-Moderation noch Nachholbedarf besteht. Online-Sicherheitsexperten und Kinderschutzorganisationen fordern, dass Spotify und andere Plattformbetreiber deutlich mehr Ressourcen und innovative Technologien einsetzen, um solche illegalen Angebotsseiten konsequent zu verhindern. Gleichzeitig müssten Regulierungsbehörden und Gesetzgeber Rahmenbedingungen schaffen, die technischen Plattformen eine klare Verpflichtung auferlegen, illegale Inhalte proaktiv zu erkennen und zu entfernen, ohne in Grauzonen zu verbleiben. Für Nutzer ist es wichtig, wachsam zu sein und niemals verschreibungspflichtige Medikamente direkt über Internetseiten zu beziehen, deren Seriosität nicht geprüft ist. Die Gefahr von gefälschten Medikamenten, falscher Dosierung und gesundheitlichen Risiken durch verunreinigte oder völlig andere Inhaltsstoffe ist enorm.
Besonders Jugendliche und junge Erwachsene sollten besser über die Risiken aufgeklärt und vor solchen Angeboten geschützt werden. Zusammenfassend zeigt der Fall von Spotify, wie komplex das Zusammenspiel von Technologie, Regulierung, öffentlicher Sicherheit und Unternehmensverantwortung im digitalen Zeitalter geworden ist. Ein kluges, umfassendes Moderationssystem und der gemeinsame Einsatz aller Beteiligten sind notwendig, um die Plattform sicher für Nutzer zu gestalten und die Verbreitung illegaler Angebote einzudämmen. Das Thema „Podcasts als Werbeplattform für illegale Medikamente“ ist ein Weckruf für die gesamte Branche, Schutzmechanismen zu überdenken und zu verstärken. Die Zukunft der Audio-Streaming-Dienste wird davon abhängen, wie schnell und effektiv sie auf solche Herausforderungen reagieren können.
Spotify hat mit seiner schnellen Entfernung von bekannten Fake-Podcasts einen ersten Schritt gemacht, aber der Ausblick zeigt auch, dass weitere, technologische und regulatorische Maßnahmen unabdingbar sind, um Nutzer umfassend zu schützen und das Vertrauen in die Plattform zu bewahren.



![State of the Art PFAS [pdf]](/images/E33CC289-68C1-497D-987E-7AF884C56089)