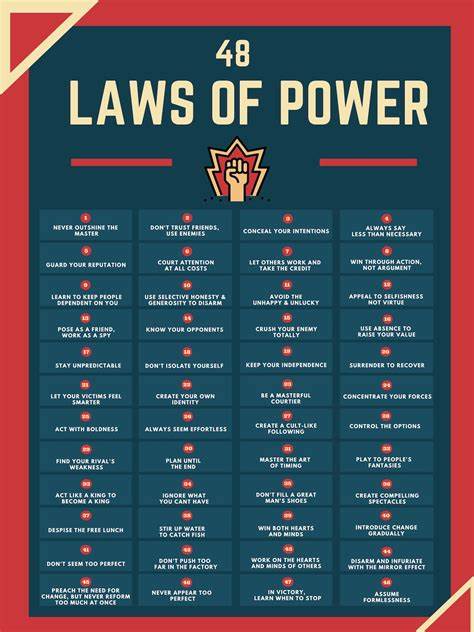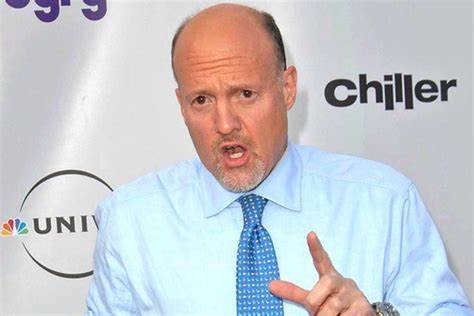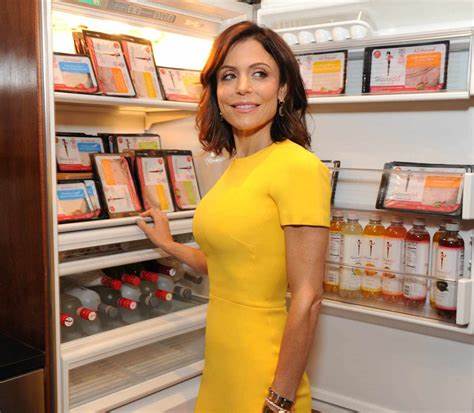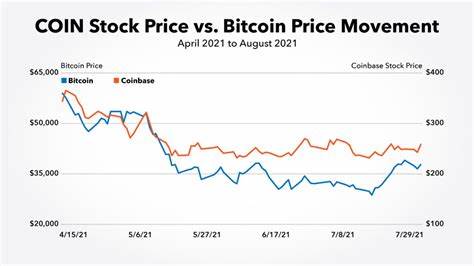Das Venture-Capital-Umfeld ist seit jeher geprägt von der sogenannten Power-Law-Verteilung, einem Prinzip, das besagt, dass der Großteil der Gewinne einer Venture-Capital-Firma von wenigen herausragenden Investitionen stammt. Dieses Modell, ausführlich behandelt im Werk „Power Law“ von Sebastian Mallaby, prägt die Grundeinstellung vieler Investoren und Gründer und legt den Fokus auf sogenannte „Moonshots“ – also auf riskante, aber potenziell extrem lukrative Investitionen, die den Markt revolutionieren können. Doch stellt sich die Frage, ob es überhaupt machbar oder sinnvoll ist, diesen Ausreißern zu trotzen und sich bewusst gegen die Power-Law-Dynamik zu positionieren. Mit anderen Worten: Ist eine Anti-Power-Law-Strategie realistisch? Und welche Alternativen gibt es? Die folgenden Ausführungen beleuchten diese Fragen detailliert und zeigen Wege auf, die das traditionelle Bild von Venture Capital herausfordern. Das herkömmliche Power-Law-Modell basiert auf einer einfachen, aber unerbittlichen Mathematik.
Ein Beispiel, das oft zitiert wird, ist die Investition von drei Millionen US-Dollar in Juniper Networks im Jahr 1996. Nach wenigen Jahren erzielte Kleiner Perkins einen Ausstiegserlös in Milliardenhöhe, was zu einem sensationellen Vielfachen der ursprünglichen Investition führte. Solche Erfolgsgeschichten zeigen eindrucksvoll, warum viele Risikokapitalgeber weiterhin alles daran setzen, genau diesen einen großen Treffer zu landen. Doch diese Erfolge sind selten und schwer reproduzierbar. Für den Großteil der VC-Fonds bedeutet das, dass die durchschnittlichen Renditen oft nicht mit den hohen Erwartungen Schritt halten können.
Die Realität vieler Fonds zeigt, dass es oft Jahre gibt, in denen keine disruptiven Ausreißer entstehen. Gleichzeitig wurden vergangene Jahre von einer Überbewertung und einer Vielzahl sogenannter „Zombie-Startups“ geprägt – Unternehmen, die zwar finanziert sind, aber keinen klaren Weg zu Wachstum oder Profitabilität finden. Diese Situation verstärkt die Kritik an der reinen Power-Law-Strategie und stellt Investoren sowie Gründer zunehmend vor die Frage, ob es Wege gibt, das Risiko zu streuen und verlässlichere Erfolgsmuster zu finden. Eine vielversprechende Alternative ist das Konzept, den Fokus auf eine höhere Trefferquote zu legen, statt auf den einen großen Ausreißer zu setzen. Das bedeutet, ein Portfolio zu schaffen, das auf mehreren soliden Gewinnen beruht, die zwar nicht jeweils Milliarden einbringen, aber im Bereich von drei- bis zehnfachen Renditen liegen.
Dieser Ansatz zielt darauf ab, das Risiko zu minimieren und eine beständigere Rendite für den Fonds zu generieren. Einige Investoren beginnen, sich von der Idee des „wilden Wachstums um jeden Preis“ zu lösen und stattdessen Geschäftsmodelle zu unterstützen, die fokussiert auf Profitabilität und Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. Dies zeigt eine Verschiebung in der Denkweise und stellt eine fundamentale Anpassung an den venturekapitalistischen Erfolgspfad dar. Eine weitere Anti-Power-Law-Strategie ist das sogenannte „Rollup“-Modell, das ursprünglich aus dem Bereich des Private Equity stammt. Hierbei geht es darum, mehrere kleinere, meist profitable Unternehmen innerhalb eines Nischenmarkts aufzukaufen und zu einem größeren, effizienteren Unternehmen zu verschmelzen.
Durch Skaleneffekte und operative Optimierungen wird ein Mehrwert geschaffen, der sich in einer höheren Bewertung und somit in attraktiveren Exit-Möglichkeiten niederschlägt. Im Gegensatz zum tradtionellen VC-Ansatz, der auf organisches Wachstum und Innovation setzt, beruht dieses Modell auf strategischem Vorgehen und operativer Expertise. Der Fokus auf „Distressed“ oder Spezialsituationen stellt eine weitere alternative Anlageform dar. Hierbei investieren Fonds gezielt in Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, sei es durch langsames Wachstum, finanzielle Engpässe oder Restrukturierungsbedarf. Während klassische VC-Firmen in solchen Fällen häufig abschreiben, sehen Anti-Power-Law-Investoren Potenzial, durch gezielte Interventionen und Problemlösungen Wert zu schaffen.
Diese Strategie erfordert ein tiefes Verständnis der Märkte, eine flexible Herangehensweise und oft auch eine langfristige Geduld, zahlt sich aber mit stabileren Renditen und geringerer Abhängigkeit von Glückstreffern aus. Aus Sicht der Gründer wächst das Interesse an alternativen Finanzierungsstrukturen, die weniger auf Hyper-Wachstum und stattdessen auf nachhaltige Profitabilität setzen. Viele Unternehmer fühlen sich dem enormen Druck, rasch in die Milliardenbewertung zu wachsen, nicht mehr gewachsen oder sind der Meinung, dass dieses Modell nicht zu ihrem Geschäft oder ihrer Vision passt. Investoren, die einer Anti-Power-Law-Philosophie folgen, können solchen Gründern attraktive Alternativen bieten. Dies führt zu einer diversifizierteren Start-up-Landschaft, in der unterschiedliche Wege zum Erfolg anerkannt und gefördert werden.
Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass Anti-Power-Law-Strategien oftmals weniger glamourös erscheinen und in der Öffentlichkeit weniger Beachtung finden. Der Medienfokus liegt nach wie vor auf den spektakulären Unicorns und Einhörnern, die mit Milliardenbewertungen den Markt prägen. Dies macht es für Anti-Power-Law-Investoren schwerer, Kapital anzuziehen, und auch Gründer müssen oftmals Überzeugungsarbeit leisten, um sich für solche Finanzierungsmodelle zu entscheiden. Nichtsdestotrotz wächst die Zahl der Beispiele, bei denen diese Strategien erfolgreich angewandt wurden, und die Akzeptanz in der Finanzwelt steigt. In der Zukunft könnte eine breitere Akzeptanz von Anti-Power-Law-Strategien das Venture-Capital-Ökosystem nachhaltiger und widerstandsfähiger machen.
Die Diversifizierung der Investitionsansätze minimiert Risiken und eröffnet neue Chancen abseits der traditionellen Tech-Hype-Investitionen. Für Investoren bedeutet dies eine Stabilisierung der Renditen, für Gründer mehr Flexibilität und für den Markt insgesamt eine gesündere Entwicklung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es durchaus machbar ist, gegen die Power-Law-Logik zu agieren und nachhaltige, konsistente Erträge zu erzielen. Die Alternative beruht auf einer strategischen Neuausrichtung, die weniger auf spektakulären Ausreißern basiert, sondern stattdessen auf einer Kombination von soliden, mehrfachen Gewinnen, operativer Wertschöpfung durch Rollups und der aktiven Sanierung von unterperformenden Unternehmen. Diese Wege erfordern eine differenzierte Herangehensweise, unternehmerisches Geschick und oft auch die Bereitschaft, gegen den Strom zu schwimmen.
Dennoch wird die Anti-Power-Law-Bewegung zunehmend als sinnvolle Ergänzung und notwendige Evolution im Venture-Capital-Bereich verstanden, die langfristig ebenso erfolgreich sein kann wie die Jagd auf den nächsten großen Unicorn-Hit.