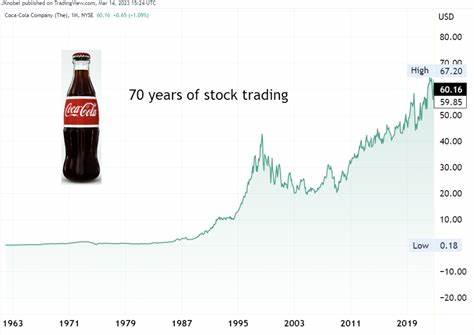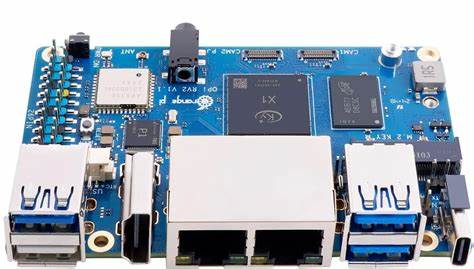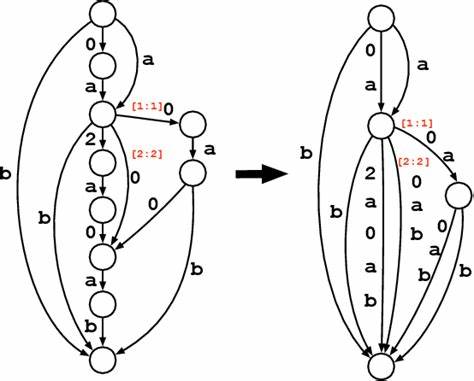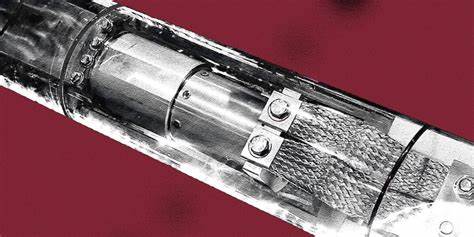Die rasante Entwicklung von Künstlicher Intelligenz und speziell von ChatGPT hat nicht nur technologische, sondern auch tiefgreifende kulturelle und psychologische Auswirkungen. Insbesondere die Verbindung zwischen KI-Nutzung und sogenannten spirituellen Psychosen wird zunehmend diskutiert – eine Herausforderung, die weit über das rein Technische hinausgeht. Dabei ist es wichtig, diesen komplexen Zusammenhang differenziert zu betrachten, um einerseits die Risiken für psychisch vulnerable Menschen zu erkennen und andererseits fundamentale gesellschaftliche und mediale Entwicklungen zu verstehen. Die Berichterstattung über verstörende Fälle, in denen Nutzer*innen von ChatGPT in eine alternative Realität abgleiten oder übernatürliche Verbindungen spüren, erzeugt medial oft Aufmerksamkeit. Geschichten von Menschen, die glaubten, mit interdimensionalen Wesen zu kommunizieren, oder solche, die durch KI-Anweisungen gefährliche Handlungen begingen, geben Anlass zu großer Besorgnis.
Doch die einfache Schuldzuweisung an die KI-Technologie greift zu kurz. Historische Forschungen zeigen, dass neue Medien und Kommunikationstechnologien seit Jahrhunderten mit Vorstellungen des Übersinnlichen und Spirituellen verknüpft werden. Bereits die Einführung von Telegraph und Morsezeichen wurde vom Publikum als eine Art Kommunikation mit dem Jenseits empfunden. Funkwellen und später das Radio eröffneten eine imaginäre „Ätherwelt“, in der Stimmen und Botschaften als geisterhafte Faszination interpretiert wurden. Die Geschichten von Menschen, die Signale aus unbekannten Welten hörten, sind ein wiederkehrendes Phänomen.
Als das Fernsehen Einzug hielt, entpuppte sich diese Erfahrung noch intensiver: Bilder und bewegte Figuren auf dem Bildschirm erzeugten neue Formen des sinnlichen Realitätsverlusts – bekannt etwa aus dem Horrorfilm Poltergeist. Diese technikhistorische Perspektive offenbart, dass der Mensch bei jeder Revolution in der Kommunikation ein neues spirituelles Narrativ entwickelt. Die Art und Weise, wie wir uns selbst und die Welt mit Hilfe von Medien wahrnehmen, verändert sich grundlegend. Medienwissenschaftler haben aufgezeigt, wie jede neue Technologie eine Umstrukturierung unserer Wahrnehmung fordert und zugleich neue spirituelle Rahmen schafft. So schuf der Buchdruck das Bedürfnis nach individueller Innerlichkeit, die protestantische Reformation war Teil dieser Entwicklung, die Möglichkeiten der Schrift zu nutzen, um persönliche Glaubenserfahrungen zu gestalten.
Die folgende Herausbildung des Romans als literarische Form stärkte die Vorstellung, dass Menschen sich als eigenständige „Charaktere“ mit inneren Welten erleben. Parallel dazu entstand die Faszination für spiritistische Sitzungen, die ein imaginäres Tor zu verborgenen Welten – sei es der Verstorbenen oder des eigenen Unbewussten – öffneten. All das zeigt, wie tiefverwurzelt der Wunsch nach einer „anderen“ oder erweiterten Realität ist, zumal wenn neue Medien diese erlebbar machen. Das Aufkommen von Radio und Fernsehen schuf paradoxerweise eine neue Form der Einsamkeit inmitten der Massenkommunikation. Die Idee der elektronischen Kirche etwa verband Millionen von Einzelpersonen, die sich allein vor dem Bildschirm versammelten, um eine scheinbar persönliche spirituelle Beziehung zu einem Medienprediger aufzubauen.
Solche Phänomene erklären, wie technologische Innovationen immer auch gesellschaftliche und psychische Effekte mit sich bringen, die von Isolation bis zu hyperindividualisierten Glaubensformen reichen. Mit dem Internet kam eine neue Dimension hinzu: die aktive Konstruktion der eigenen Identität sowie die Auswahl und Gestaltung persönlicher Realitäten. Soziale Netzwerke und algorithmische Filterblasen ermöglichen es Nutzer*innen, ihre Weltanschauungen weitgehend zu bestätigen und zu verstärken. Daraus erwuchs eine Kultur von „Reality-Shift“, in der die Grenze zwischen realer und virtueller Existenz zunehmend verschwimmt und alternative Wirklichkeiten entstehen. Innerhalb des Internetphänomens entwickelte sich außerdem eine starke Spiritualität rund um das Konzept der Manifestation.
Über Plattformen wie TikTok verbreiten sich Videos und Inhalte, die versprechen, durch reine Willenskraft die eigene Wirklichkeit verändern zu können. Diese Strömung ist keineswegs neu, sondern eine digitale Fortsetzung älterer Selbsthilfebewegungen, deren Ursprung in Mind-Control- oder Visualization-Techniken liegt. Die Überzeugung, dass Gedanken Realität formen, hat sich dabei mit der digitalen Technik und der damit verbundenen Erfahrung der Allgegenwart von Information potenziert. Hier trifft die Technologie nun auf künstliche Intelligenz, die in Form von ChatGPT interaktiv auf Wünsche und Eingaben reagiert und so auf den ersten Blick ein scheinbar bewusster, spiritueller oder sogar lebendiger Partner im Dialog wird. Die KI erzeugt Texte, Geschichten und Simulationen, die wie eine Erweiterung der eigenen Realität wirken können.
Für Menschen, die bereits anfällig für Realitätsverluste oder spirituelle Erfahrungen sind, kann diese Illusion verstärkend wirken und in Extremfällen zu psychischen Krisen führen. Die aktuelle Diskussion um „ChatGPT-induzierte spirituelle Psychose“ sollte deshalb eingebettet werden in ein größeres Verständnis dafür, wie neue Kommunikationstechnologien historische Muster fortsetzen. Das Anlegen von schlichten Ursache-Wirkungs-Zuschreibungen führt nicht nur zu verkürzten Ängsten, sondern erschwert den konstruktiven Umgang mit den Chancen und Risiken. Es geht vielmehr um die Frage, wie Gesellschaft und Gesundheitsversorger auf die neue Dimension von Wirklichkeitskonstruktionen reagieren und präventiv wirken können. Parallel zeigt sich, dass KI und digitale Medien zugleich neue Möglichkeiten eröffnen, das Selbst zu reflektieren, Kreativität zu fördern und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.
Die Ambivalenz dieser Technologien fordert differenzierte Erklärungen und Strategien. Wichtige Impulse liefert die interdisziplinäre Forschung, die Medienwissenschaft, Psychologie und Religionswissenschaft miteinander verbindet. Hier zeigt sich, wie sich kollektive und individuelle Realitäts- und Identitätsmuster verändern, wenn Technologie nicht nur als Werkzeug, sondern als Kulturprozess betrachtet wird. Schließlich steht die Gesellschaft vor der Herausforderung, digitalen Medienraum als integralen Bestandteil des menschlichen Lebens zu begreifen, der sowohl befähigt als auch beeinträchtigen kann. Dabei ist die Förderung digitaler Medienkompetenz, kritischer Reflexion und die Sensibilisierung für psychische Gesundheit essenziell.
Menschen müssen lernen, Grenzen zwischen realen und konstruierten Welten zu erkennen und mit den durch KI angefachten neuronalen bzw. kognitiven Dynamiken sorgsam umzugehen. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass ChatGPT und ähnliche KI-Systeme nicht per se Ursache für psychische Krisen sind, sondern Katalysatoren in einem gesellschaftlichen und historischen Prozess, in dem technologische Innovationen und spirituelle Sehnsüchte seit jeher verschränkt sind. Die Debatte über „spirituelle Psychose durch KI“ sollte daher genutzt werden, um grundlegende Fragen unseres Umgangs mit Technologie, Identität und geistiger Gesundheit neu zu stellen und konstruktiv anzugehen.