Quantencomputer haben in den letzten Jahrzehnten großes Interesse sowohl in der Wissenschaft als auch in der Öffentlichkeit geweckt. Sie versprechen revolutionäre Berechnungen, die für klassische Computer unerreichbar sind, insbesondere bei der Lösung komplexer Probleme in den Bereichen Kryptographie, Materialwissenschaft und Optimierung. Dennoch existiert eine wachsende Kontroverse um die tatsächliche Machbarkeit dieser Technologie. Warum können Quantencomputer möglicherweise nicht funktionieren? Gil Kalai, ein angesehener Mathematiker der Hebrew University of Jerusalem und Yale University, liefert in seiner Arbeit „Warum Quantencomputer nicht funktionieren können“ eine tiefgründige kritische Analyse, die die technischen und theoretischen Grenzen der Quantencomputer widerspiegelt. Die Grundidee hinter Quantencomputern basiert auf den Eigenschaften der Quantenmechanik, insbesondere Superposition und Verschränkung.
Diese ermöglichen ein exponentielles Wachstum der Rechenkapazität gegenüber klassischen Computern, indem Quantenbits (Qubits) mehrere Zustände gleichzeitig annehmen können. Die Theorie klingt verlockend, doch die praktische Umsetzung konfrontiert Wissenschaftler mit gravierenden Problemen, hauptsächlich im Bereich der Dekohärenz und Fehlerkorrektur. Die empfindlichen Quantenzustände können leicht durch äußere Einflüsse oder kleinste Umgebungsstörungen gestört werden, wodurch Berechnungen fehlerhaft oder unbrauchbar werden. Kalai argumentiert, dass das Problem der Fehlerkorrektur in Quantencomputern grundsätzlich unterschätzt wird. Während klassische Computer auf etablierte Algorithmen zur Fehlerkorrektur setzen, sind die quantenmechanischen Zustände viel fragiler und können durch jede Messung oder Umgebungseinwirkung kollabieren.
Die vorgeschlagenen Quantenfehlerkorrekturcodes sind komplex, erfordern jedoch eine Vielzahl von zusätzlichen Qubits und stellen somit immense technische Herausforderungen dar. Zudem zeigt Kalai, dass das Zusammenspiel von Fehlerquellen und fehlerkorrigierenden Protokollen so komplex ist, dass eine praktische Realisierung auf lange Sicht wohl nicht möglich sei. Ein weiterer zentraler Punkt seiner Analyse ist das sogenannte Noisy-Intermediate-Scale-Quantum (NISQ) Zeitalter, in dem sich die heutigen Quantenprozessoren befinden. Diese Geräte verfügen über begrenzte Qubit-Anzahlen und sind anfällig für Fehler ohne vollständige Fehlerkorrektur. Obwohl sie das Potenzial haben, bestimmte spezielle Berechnungen schneller durchzuführen als klassische Computer, gibt es bisher keine überzeugenden Belege dafür, dass sie einen bedeutenden Vorteil im praktischen Sinne bieten.
Kalai warnt, dass die Fortschritte im NISQ-Bereich möglicherweise überschätzt werden und dass die damit verbundenen Fehler und Limitationen eine Skalierung auf große, fehlerkorrigierte Quantencomputer verhindern. Neben den technischen ist auch eine theoretische Hürde zu bedenken: die Komplexität der Simulation von Quantencomputern. Es wird angenommen, dass ein klassischer Computer Quantensysteme effizient simulieren kann, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Wenn Kalai Recht hat, sind reale Fehler und Störungen so ausgeprägt, dass das Verhalten von Quantencomputern letztlich wieder klassisch simuliert werden kann – dies widerspricht der Hoffnung auf exponentielle Überlegenheit. Darüber hinaus weist Kalai auf dem mathematischen Fundament von Quantencomputern hin, insbesondere auf Probleme bei der Modellierung der physikalischen Realitäten.
In seinen Augen basieren viele Annahmen über die Skalierbarkeit und die Fehlerdynamik auf idealisierten Modellen, die in experimentellen Umgebungen nicht vollständig reproduziert werden können. Seine These ist, dass diese fundamentalen Diskrepanzen zwischen Theorie und Praxis das Haupthindernis für funktionsfähige Quantencomputer darstellen. Die Forschungsgemeinschaft ist zwischen Optimisten und Skeptikern gespalten. Erste Erfolge im Bau kleiner Quantenprozessoren und Experimente auf NISQ-Geräten zeigen beeindruckende Fortschritte, doch es gibt weiterhin keine allgemein akzeptierte Methode, um die Herausforderungen der Skalierung und Fehlerbehandlung zu überwinden. Kritiker wie Kalai mahnen einen realistischen Blick an und fordern ein Umdenken weg von übermäßiger Euphorie hin zu einer nüchternen Bewertung, welche Probleme im Kern gelöst werden müssen.
Auch wenn der Traum von gleichzeitig vielen Rechenoperationen durch Qubits verführerisch bleibt, sind die praktischen Schwierigkeiten bei der Erzeugung und Erhaltung kohärenter Quantenzustände immens. Der Einfluss von Dekohärenz, thermischem Rauschen und weiteren Umweltstörungen wirkt wie ein permanenter Bremsfaktor. Hinzu kommen materielle und technologische Herausforderungen wie die Notwendigkeit extremer Kühlung und das Design hochpräziser Steuerungssysteme. Diese Komplexität erhöht exponentiell mit der Anzahl der Qubits, was derzeitige Technologien vor unüberwindbare Hürden stellen könnte. Ein weiterer Aspekt, der Kalai hervorhebt, ist die Notwendigkeit einer vollständigen Fehlerkorrektur für skalierbare Quantencomputer, ohne die eine effiziente Nutzung nicht möglich ist.
Die bislang vorgeschlagenen Methoden sind zwar theoretisch vielversprechend, weisen jedoch praktische Mängel auf, die eine umfassende Implementierung erschweren oder unmöglich machen könnten. Somit könnte Quantencomputing aufgrund seiner inhärenten Fehleranfälligkeit eher eine theoretische als eine praktikable Technologie bleiben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Behauptung „Warum Quantencomputer nicht funktionieren können“ eine provokante, jedoch ernstzunehmende Perspektive in einer Diskussion darstellt, die von großer wissenschaftlicher und technologischer Bedeutung ist. Es ist ein Appell zu mehr kritischem Denken und realistischen Erwartungen, der die Notwendigkeit unterstreicht, technische, physikalische und theoretische Grenzen konsequent zu adressieren. Obwohl die mögliche Zukunft von Quantencomputern verlockend erscheint, fordert die derzeitige Forschung zur Vorsicht auf.
Die Herausforderungen, die in Gil Kalais Arbeit detailliert beschrieben werden, weisen darauf hin, dass eine funktionierende, großskalige Quantenrechenmaschine noch lange nicht in Reichweite ist – möglicherweise sogar prinzipiell ausgeschlossen ist. Dies bedeutet jedoch nicht das Ende der Quantenforschung. Stattdessen sollte mehr Augenmerk auf alternative Ansätze und sogar potenziell realistischere Berechnungsmethoden gelegt werden, um die komplexen Probleme von morgen anzugehen. Die Diskussion um die Machbarkeit von Quantencomputern bleibt spannend und relevant. Sie fordert Wissenschaftler, Ingenieure und Philosophen gleichermaßen heraus, die Möglichkeiten und Grenzen der Quantenwelt realistisch einzuschätzen.
Letztlich ist das Verstehen der Gründe, warum Quantencomputer nicht funktionieren können, ebenso wichtig wie die Jagd nach deren Erfolg – denn nur so kann nachhaltiger Fortschritt entstehen.
![Why Quantum Computers Cannot Work [pdf]](/images/E88D4AD6-8F00-4F8F-B11F-006C333AA7E5)


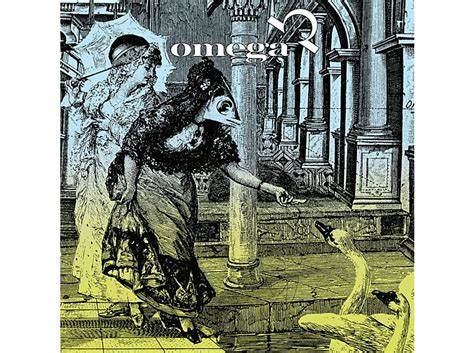



![Opening the Doors of Creativity [video] (1990)](/images/77411B4D-DD1C-4184-9CB7-7C8BC7DBA530)

