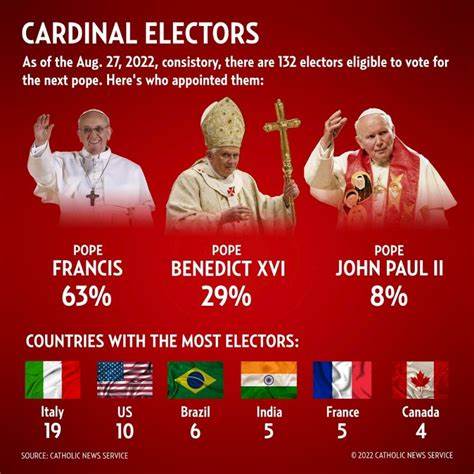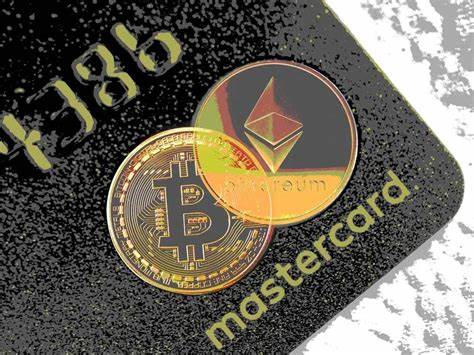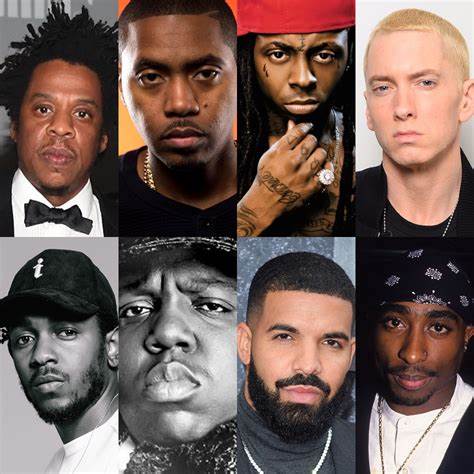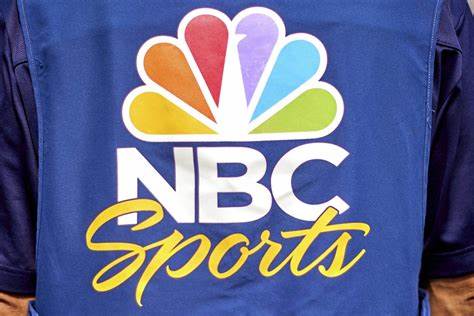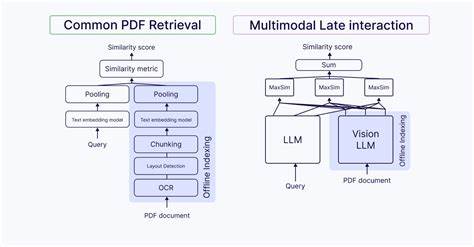Die europäische Raumfahrtagentur ESA hat mit der Mission Proba-3 einen bedeutenden Meilenstein in der Weltraumtechnologie erreicht. Zum ersten Mal gelang es, zwei separate Satelliten im Orbit so präzise aufeinander auszurichten, dass sie sich auf nur wenige Millimeter genau formieren und diese exakte Position über Stunden autonom beibehalten konnten – ohne jede Steuerung von der Erde. Diese sogenannte Formation Flying-Technologie hat das Potenzial, künftige Raumfahrtmissionen grundlegend zu verändern. Die Fähigkeit, mehrere Objekte im Weltraum kontrolliert und in perfekter Abstimmung zueinander zu bewegen, eröffnet neue Möglichkeiten für komplexe wissenschaftliche Instrumente und größere Beobachtungsvolumina, die sonst mit einem einzigen Satelliten nicht realisierbar wären. Die Mission Proba-3 besteht aus zwei Raumfahrzeugen: dem Coronagraphen und dem Occulter, die im Abstand von etwa 150 Metern im Orbit operieren.
Gemeinsam simulieren sie ein einzelnes, riesiges Raumfahrzeug, indem der Occulter die Sonne so verdeckt, dass der Coronagraph die lichtschwache Sonnenkorona erforschen kann. Dies ermöglicht detailliertere und länger anhaltende Beobachtungen der äußeren Sonnenatmosphäre, die auf der Erde nicht durchführbar sind. Die präzise Ausrichtung der beiden Satelliten ist dabei entscheidend, da der Occulter eine Scheibe von 1,4 Metern Durchmesser trägt, deren Schatten exakt auf das optische Instrument des Coronagraphen fallen muss – ein 5 Zentimeter großer Bereich, der perfekt getroffen werden muss. Die Herausforderung liegt in der Haltung der Formation bei etwa 50.000 Kilometern Entfernung von der Erde.
In dieser Höhe wirkt die Erdanziehungskraft nur noch sehr schwach, sodass nur ein minimaler Treibstoffverbrauch notwendig ist, um die Satelliten in Position zu halten. Die Satelliten begeben sich dabei in einem zyklischen Verfahren in Formation. Die Formation wird nach einem Orbitsegment gelöst und dann wieder neu aufgebaut, wobei das System für das Stabilhalten und die genaue Positionierung autonom arbeitet. Um diese Präzision zu erreichen, setzt Proba-3 auf eine Kombination innovativer Technologien. Die Satelliten sind mit einer Vielzahl von Sensoren ausgestattet, die ständig ihre relative Position messen und an das Steuersystem melden.
Ein wichtiger Bestandteil ist das visuelle System, bei dem eine Weitwinkelkamera am Occulter blinkende LEDs am Coronagraphen verfolgt. Sobald die Entfernung gering genug ist, übernimmt eine schmalwinkelige Kamera, die eine noch präzisere Ausrichtung ermöglicht. Der entscheidende Durchbruch kam jedoch mit der Integration eines Laserinstrumentes, dem sogenannten Fine Lateral and Longitudinal Sensor (FLLS). Dieses Gerät sendet einen Laserstrahl vom Occulter zum Coronagraphen, wo dieser von einem Retroreflektor zurückgeworfen wird. Die daraus gewonnenen Messwerte erlauben eine Positionserfassung mit Millimeter-Genauigkeit.
Zusammen mit einem Schattenpositionierungssensor, der die Lichtintensität rund um die Öffnung des Coronagraphen erfasst, gewährleistet ein onboard Algorithmus, dass sich der Coronagraph im genau richtigen Schattenbereich des Occulters befindet. Das Zusammenspiel der verschiedenen Sensoren und der fortschrittlichen Navigations-, Steuerungs- und Regelungssoftware ermöglicht eine unvergleichliche Stabilität der Formation, die alle Erwartungen übertrifft. Dies zeigt, wie weit die ESA heute auf dem Gebiet der autonomen Formation Flying-Technologie ist. Die Mission wurde von einem internationalen Konsortium unter der Führung von Spanien und mit Beteiligung von mehr als 29 Unternehmen aus 14 Ländern umgesetzt. Die wissenschaftlichen Instrumente kommen unter anderem aus Belgien, während die Datenverarbeitung von dortigen Weltraumbeobachtungszentren übernommen wird.
Neben der technologischen Innovation birgt Proba-3 auch großes wissenschaftliches Potenzial. Indem die Sonnenkorona mit solchen Instrumenten detailliert untersucht wird, profitieren Forscher von neuen Erkenntnissen über Sonnenwinde, Magnetfelder und ungewöhnliche Koronastrukturen. Dieses Wissen ist für ein besseres Verständnis der Sonne und ihrer Auswirkungen auf das Weltraumwetter von großer Bedeutung. Der erfolgreiche Start von Proba-3 fand am 5. Dezember 2024 auf einer indischen PSLV XL Trägerrakete statt.
Die darauffolgenden Monate der Erprobung und Feinabstimmung im Orbit demonstrieren nicht nur die technische Machbarkeit, sondern auch die Zuverlässigkeit der autonomen Systeme über lange Zeiträume. Das Team hinter Proba-3 blickt zuversichtlich auf die kommende Phase, in der die vollständige Kalibrierung der Instrumente abgeschlossen und die erste hochwertige Aufnahme der Sonnenkorona erwartet wird. Proba-3 zeigt exemplarisch, wie neue Technologien in der Raumfahrt nicht nur die Grenzen des technisch Machbaren verschieben, sondern auch konkrete wissenschaftliche Vorteile bringen. Die Kombination aus hochpräziser Lasermessung und Kamerasystemen zur Positionsbestimmung bildet zukünftig die Basis für komplexe Formation-Flug-Missionen mit mehreren Satellitenverbünden und könnte in der Zukunft Anwendungen in der Erdbeobachtung, Astrophysik und sogar der bemannten Raumfahrt finden. Durch die Demonstration von Millimeter-Genauigkeit beim Formation Flying setzt Proba-3 neue Standards für internationale Raumfahrtprojekte.
Die ESA bestätigt damit ihre Rolle als führende Agentur bei der Entwicklung innovativer Technologien zur Erkundung des Weltraums. Diese Mission zeigt, wie Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg und die enge Verzahnung von Industrie, Wissenschaft und Raumfahrtorganisationen erfolgreich zu herausragenden Ergebnissen führen können. Insgesamt markiert Proba-3 einen bedeutenden Fortschritt für die Raumfahrttechnik. Die präzise und autonome Steuerung von zwei Raumfahrzeugen in linkerartiger Formation eröffnet ein neues Kapitel, in dem immer komplexere Mehrfachsysteme im All operieren können. Die gewonnenen Erfahrungen und Technologien werden Vorbildcharakter haben und bei zahlreichen zukünftigen Projekten Eingang finden.
Für die Erforschung der Sonne bringt Proba-3 darüber hinaus einen Quantensprung, der das Verständnis unserer Heimatsternumgebung vertieft und damit auch zur Absicherung der Technologien auf der Erde beiträgt. Angesichts dieser Erfolge und der spannenden Möglichkeiten, die sich am Horizont abzeichnen, ist Proba-3 ein Paradebeispiel für verantwortungsvolle, nachhaltige und zukunftsweisende Weltraumforschung. Die präzise Formation Flying-Technik könnte ihre Anwendung weit über die Sonnenbeobachtung hinaus finden und den Weg für zahlreiche neue Missionen ebnen, die in den kommenden Jahrzehnten die Erforschung des Alls weiter vorantreiben werden.