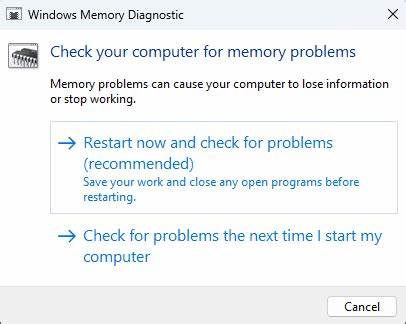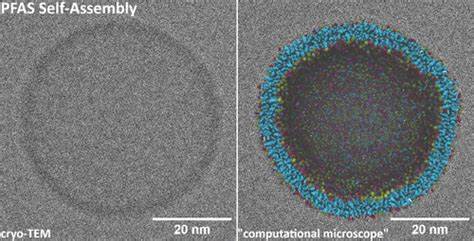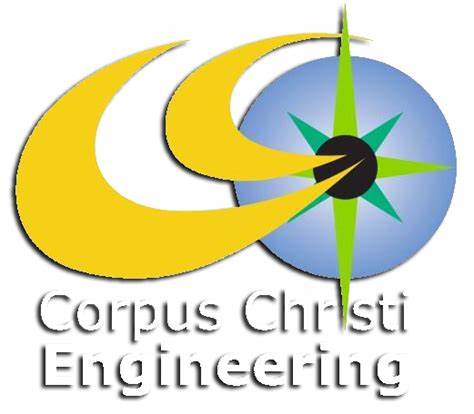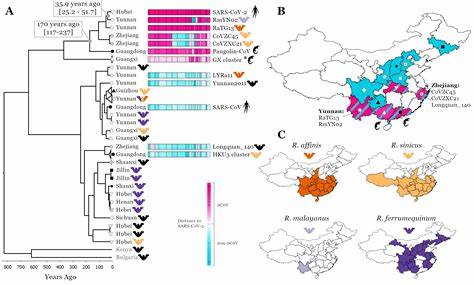In den letzten Jahren stand Apple immer wieder wegen seiner strikten Kontrolle des App Stores im Fokus von Kritik und juristischen Auseinandersetzungen. Insbesondere die Auseinandersetzung mit Epic Games im Zusammenhang mit dem beliebten Spiel Fortnite hat eine Debatte über Macht, Marktbeherrschung und faire Wettbewerbsbedingungen angestoßen. Die jüngste Entscheidung von Richterin Yvonne Gonzalez Rogers bringt nun frischen Wind in die Diskussion und könnte langfristige Konsequenzen für den App Store, Entwickler und Anwender in den USA mit sich bringen. Diese Gerichtsentscheidung beleuchtet nicht nur die rechtlichen Grenzen, die Apple bei der Durchsetzung seiner App-Store-Richtlinien hat, sondern zeigt auch ein neues Gleichgewicht zwischen Plattformbetreibern und ihren Nutzern auf. Dabei stehen insbesondere die sogenannten „Anti-Steering“-Regeln und das komplexe Thema der Provisionen im Mittelpunkt.
Die Vorgeschichte der juristischen Auseinandersetzung reicht zurück bis 2021, als Richterin Rogers das erste Mal über den Epic Games Rechtsstreit entschied. Obwohl die meisten Klagepunkte von Epic Games abgewiesen wurden, gab sie dennoch zu, dass Apples Anti-Steering-Regel problematisch ist. Diese Regel verbietet App-Entwicklern, Nutzer auf alternative Zahlungsmethoden außerhalb von Apples In-App-Käufen hinzuweisen. Das führte dazu, dass populäre Dienste wie Netflix oder Spotify gezwungen waren, Apples etwa 15 bis 30 Prozent Provision auf Abonnements zu akzeptieren, ohne ihre Kunden offen über günstigere Zahlungsoptionen außerhalb des App Stores zu informieren. Diese Praxis wurde von der Justiz als wettbewerbswidrig und Verbrauchertäuschung kritisiert und als Verstoß gegen kalifornisches Wettbewerbsrecht eingestuft.
Trotz des ursprünglichen Urteils dauerte es mehr als zwei Jahre, bis die entsprechenden Maßnahmen tatsächlich umgesetzt wurden. Apple hatte erfolgreich gegen das ursprüngliche Urteil Berufung eingelegt und so die Umsetzung der gerichtlichen Anordnungen verzögert. Erst als der Oberste Gerichtshof der USA im Januar 2024 die Berufung ablehnte, trat das Verbot der Anti-Steering-Regeln endgültig in Kraft. Apples darauffolgende Reaktion brachte einige Überraschungen mit sich, denn anstatt die neue Ausgangslage zu akzeptieren, wollte Apple weiterhin von den Käufen außerhalb des App Stores profitieren. Apple implementierte eine neue Regel, die besagt, dass Entwickler eine sogenannte „Erlaubnis“ oder ein „Entitlement“ von Apple benötigen, um Links oder Buttons zu externen Zahlungsmethoden einzusetzen.
Dabei verfolgte Apple das Ziel, diese externen Käufe zu beobachten und weiterhin eine Provision von bis zu 27 Prozent zu erhalten, selbst wenn der Kauf nicht über den App Store getätigt wurde. Dieses Vorgehen sorgte bei vielen Beobachtern, sogar bei einigen Apple-Fans, für Unmut. Kritiker wie der bekannte Technikjournalist John Gruber bezeichneten diese Praxis als „Gier und Habsucht“ und warnten, dass Apples Markenschaden dadurch nur noch größer werde. Epic Games reagierte umgehend und reichte eine neue Klage gegen Apple ein, um diese Politik zu stoppen. Die Richterin zeigte sich unbeeindruckt von Apples Strategie.
Sie sprach von einer „offensichtlichen Vertuschung“, da Apple bei den ersten Anhörungen gezielt manipulierte und maßgeschneiderte Beweise vorlegte, um die Situation zu verschleiern. Nach intensiven Untersuchungen und einer zweiten Anhörungsrunde verstärkte Richterin Rogers das ursprüngliche Urteil mit noch schärferen Formulierungen und neuen Auflagen. Apple wurde untersagt, weitere wettbewerbswidrige Barrieren zu errichten, und einige Führungskräfte bei Apple wurden sogar wegen Falschaussagen vor Gericht maßregelt, darunter auch Apples Finanzvorstand Alex Roman, der unter Eid falsche Angaben gemacht haben soll. Für den App Store bedeutet diese juristische Entwicklung eine fundamentale Veränderung. Während das ursprüngliche Urteil von 2021 lediglich vorsah, dass Apps nun Buttons und Links zu externen Zahlungsmethoden hinzufügen dürfen, ohne dass Apple dies verbietet, stellt das jüngste Urteil noch härtere Regeln auf.
Apple darf keinerlei Provisionen oder Gebühren für Transaktionen verlangen, die extern getätigt werden. Ebenso ist Apple nicht berechtigt, diese Käufe zu verfolgen oder zu überwachen, sofern die Nutzer sich nicht bewusst für eine In-App-Kaufoption von Apple entscheiden. Diese Entscheidung hat weitreichende Auswirkungen, nicht zuletzt für die Entwickler, die nun selbst bestimmen können, wie sie Zahlungsoptionen kommunizieren und umsetzen. Dennoch untersagt das Urteil weiterhin, dass Entwickler eigene In-App-Kaufsysteme vollständig innerhalb der App integrieren. Die Verlinkung auf externe Webseiten oder Shops bleibt der einzige Weg, um Abweichungen von Apples Zahlungssystem zu ermöglichen.
Apple kündigte unmittelbar nach dem Urteil an, die Vorgaben zu befolgen, obwohl das Unternehmen weiterhin gegen die Entscheidung Berufung einlegen möchte. Die App Store Richtlinien für den US-amerikanischen Markt wurden entsprechend angepasst und es wurde ein spezielles Entwickler-Mailing verschickt, das die Änderungen erklärt. Die neuen Regeln betreffen zunächst nur Apps, die im US-App Store angeboten werden. Entwickler von global nutzbaren Apps müssen also weiterhin unterschiedliche Zahlungsregeln für Nutzer auf verschiedenen Märkten umsetzen, was die Handhabung komplizierter gestaltet. Für die Nutzer bedeutet das Urteil eine größere Transparenz und Freiheit bei digitalen Zahlungen.
Sie können direkt über alternative, oft günstigere Zahlungsmöglichkeiten kaufen, ohne versteckte Gebühren oder Einschränkungen. Die Verpflichtung, externe Links im Standardbrowser Safari zu öffnen, anstatt sie in einem In-App-Browser zu integrieren, stellt sicher, dass Nutzer klar informiert werden, wenn sie eine App verlassen und auf eine externe Webseite wechseln. Damit will das Gericht verhindern, dass Apple Nutzern „durch die Hintertür“ weiterhin bestimmte Angebote verschleiert oder erschwert. Die juristische Schlacht rund um den App Store ist ein Indikator für die wachsende Auseinandersetzung mit den Machtstrukturen im digitalen Ökosystem. Zahlreiche Regulierungen weltweit nehmen digitale Plattformen zunehmend stärker in den Blick und definieren, wie offene Märkte und faire Wettbewerbsbedingungen aussehen sollten.
Apples Vorgehensweise zeigt, wie schwer es für Großunternehmen ist, sich an neue rechtliche Rahmenbedingungen anzupassen, wenn diese ihre bisherigen Profitmodelle infrage stellen. Zudem ist die Entscheidung ein Signal für andere Plattformbetreiber, die ihre Geschäftsmodelle auf geschlossene Ökosysteme und hohe Lizenzgebühren stützen. Die Folgen könnten weit über Cupertino hinausreichen und Impulse für eine liberale und verbraucherfreundlichere Entwicklung digitaler Märkte setzen. Entwickler erhalten endlich die Möglichkeit, ihre Kunden direkter und ohne Abschöpfung durch Apple zu erreichen, was insbesondere für kleinere und unabhängige Unternehmen ein großer Vorteil sein kann. Gleichzeitig steht Apple vor der Herausforderung, seine Geschäftsstrategie neu auszurichten und alternative Einnahmequellen zu erschließen, um den Wegfall hoher Provisionen teilweise zu kompensieren.