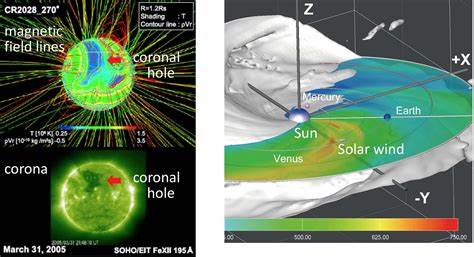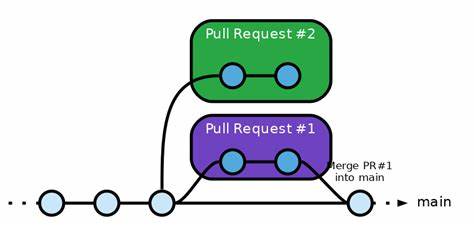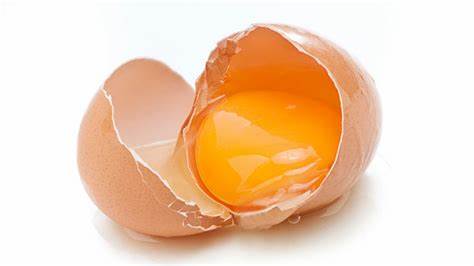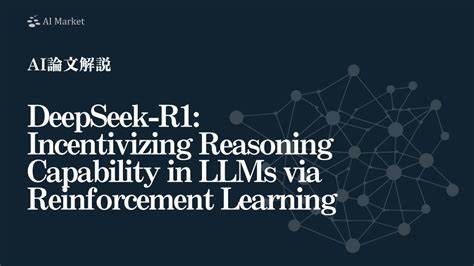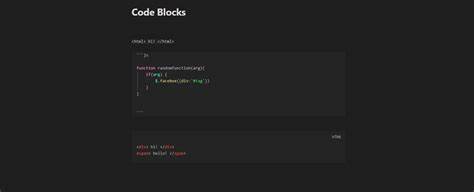Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) und deren Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft ist gegenwärtig allgegenwärtig. Viele sprechen von revolutionären Wachstumsraten und tiefgreifenden Veränderungen, doch wie realistisch sind diese Erwartungen? In einem aufschlussreichen Gespräch diskutierten Tyler Cowen, ein renommierter Ökonom, und Jack Clark, ein Experte im KI-Bereich, genau diese Fragen. Ihre Analyse bietet eine ausgewogene, teilweise skeptische Perspektive auf die Zukunft der Wirtschaft in Verbindung mit fortschrittlichen KI-Technologien. Jack Clark weist darauf hin, dass die gegenwärtige Wachstumsrate der US-Wirtschaft zwischen ein und zwei Prozent liegt, was mit der allgemein bekannten Realität übereinstimmt. Er selbst geht von einer eher konservativen Prognose für das Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren aus, mit einem pessimistischen Szenario um drei Prozent und einem optimistischen bei fünf Prozent jährlich.
Diese Zahlen stehen im Gegensatz zu den ambitionierteren Erwartungen einiger Tech-Insider, die von zweistelligen Wachstumsraten träumen. Clark betont, dass diese Diskrepanz aus der realistischen Einschätzung resultiert, dass viele Wirtschaftsbereiche langsam wachsen oder technologische Neuerungen nur zögerlich adaptieren. Besonders Branchen wie das Gesundheitswesen stellen erhebliche Herausforderungen für schnelle Innovationen dar. Ein wesentlicher Punkt, den Clark zur Sprache bringt, ist die Kluft zwischen der digitalen Welt, in der Künstliche Intelligenz bis dato hauptsächlich operiert, und der physischen Welt, wo die produktive Anwendung auf Probleme stößt. Beispiele wie autonome Fahrzeuge zeigen, dass trotz technischer Fortschritte die Skalierung und praktische Anwendung mit enormen Schwierigkeiten verbunden sind.
Er beschreibt es als eine Vielzahl von kleinen Problemen, die zusammen eine unüberwindbare Barriere darstellen. Diese sogenannten „letzten Meilen“-Probleme führen dazu, dass Fortschritte im Labor oft sehr viel langsamer in der realen Welt ankommen als ursprünglich prognostiziert. Dasselbe gilt in hohem Maße für Robotik im Allgemeinen. Das Beispiel des Trainings von robotischen Händen mit einer Erfolgsquote von nur etwa 60 Prozent illustriert anschaulich die derzeitigen Einschränkungen. Für Endnutzer, wie etwa Eltern mit kleinen Kindern, wären solche technischen Methoden schlichtweg inakzeptabel.
Tyler Cowen vertritt in dem Gespräch eine ähnliche Ansicht und spricht von einer Wachstumssteigerung durch KI von etwa einem halben Prozentpunkt, wobei fünf Prozent als absolute Obergrenze gelten. Er bewundert zwar die Innovationskraft, bleibt jedoch bei seinen Erwartungen vorsichtig. Interessant wird auch die Frage, wie sich KI auf unterschiedliche Wirtschaftssektoren unterschiedlich auswirken wird. Clark erinnert daran, dass ein hochdynamischer Teil der Wirtschaft sicherlich schneller wächst, aber relativ klein ist, während andere Bereiche, etwa die öffentliche Verwaltung oder traditionelle Industrien, sich langsamer anpassen werden. Das Gespräch beleuchtet auch rechtliche und politische Hindernisse, die die Umsetzung von KI-Lösungen im Alltag erschweren.
Es gibt eine Vielzahl an regulatorischen Fragen rund um autonome Agenten, Datenschutz, nationale Souveränität und die Verteilung von Produktivitätsgewinnen. Gerade hier, so Clark, stellen sich komplexe Probleme, die regulatorische Langsamkeit sowie gesellschaftliche Widerstände bedingen. Die Debatte um den Umgang mit KI im journalistischen Bereich ist ein weiteres Beispiel, wo sich neue Technologien mit traditionellen Berufsfeldern und ethischen Herausforderungen vermischen. Auch wenn beide Diskutanten die derzeitige Begeisterung für künstliche Intelligenz teilen, zeigen sie sich skeptisch gegenüber allzu optimistischen Erwartungen. Clark betont, dass die Probleme bei der Übertragung digitaler Innovationen in physische Anwendungen nicht unterschätzt werden dürfen.
Dieses hohe Maß an Komplexität ist es, das den Fortschritt möglicherweise bremst – trotz der enormen Investitionen und technologischen Durchbrüche, die wir beobachten. Diese Vorsicht wird auch durch historische Vergleiche untermauert, bei denen neue Technologien häufig nicht sofort zu einer exponentiellen Produktivitätssteigerung führten. Zudem wurde die Rolle von KI in der Arbeitswelt diskutiert. Während viele in der Technologie eine potenzielle Bedrohung für Arbeitsplätze sehen, betonen Cowen und Clark, dass vor allem einfache, repetitive Tätigkeiten automatisiert werden könnten. Hochqualifizierte Jobs, insbesondere in Managementpositionen, dürften vorerst unangetastet bleiben, da diese Rollen komplexe soziale Interaktionen und Entscheidungskompetenzen erfordern, die KI bisher nicht zuverlässig übernehmen kann.
Es wurde auch der Begriff der „Manager-Nerds“ angesprochen, die künftig eine Brücke zwischen technologischer Expertise und Managementkompetenz bilden könnten. Interessante Perspektiven ergeben sich auch bei der Betrachtung der geopolitischen Dimension der KI-Entwicklung. Clark sieht Länder wie Großbritannien und Singapur als mögliche künftige KI-Hubs, die durch gezielte Investitionen und politische Weichenstellungen attraktiv für Innovation sein könnten. Dies steht im Kontext eines globalen Wettbewerbs um technologische Vorherrschaft und attraktive Standorte für Unternehmen im KI-Bereich. Im Gespräch wird auch die gesellschaftliche Dimension nicht außer Acht gelassen.
Junge Generationen stehen vor Herausforderungen, sich in einem zunehmend von KI geprägten Umfeld zurechtzufinden. Einige Kommentatoren im weiteren Diskurs äußerten Sorgen, dass insbesondere Jugendliche, die in den letzten Jahren heranwuchsen, sich einer Welt gegenübersehen könnten, in der traditionelle Bildungsinhalte weniger relevant sind, während gleichzeitig auch neue Kompetenzen schwer zu vermitteln sind. Die mögliche Spaltung zwischen „AI-Literaten“ und anderen Bevölkerungsgruppen könnte damit vergrößert werden. Das Gespräch zwischen Tyler Cowen und Jack Clark zeichnet ein differenziertes Bild der nahen Zukunft, in der Künstliche Intelligenz zwar signifikante Veränderungen bringen wird, diese aber durch physische, regulatorische und gesellschaftliche Herausforderungen gedämpft werden. Die Wachstumsraten, so der Konsens, werden realistischerweise moderat ausfallen.