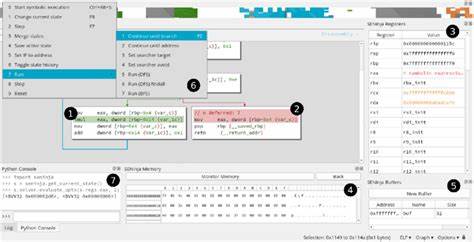Die Frage nach der Herkunft des modernen Menschen, Homo sapiens, zählt seit Jahrhunderten zu den bedeutendsten und zugleich umstrittensten Themen der Anthropologie. Für lange Zeit dominierte die sogenannte „Out-of-Africa“-Theorie, nach der der moderne Mensch vor etwa 100.000 bis 120.000 Jahren in Afrika entstand und anschließend verschiedene Teile der Welt besiedelte, während er zuvor existierende Menschenarten, wie etwa Homo erectus oder Neandertaler, ersetzte. Doch Eingriffe in dieses etablierte Narrativ erfolgen immer wieder – nicht zuletzt dank bahnbrechender Entdeckungen, wie sie der australische Anthropologe Alan Thorne bei Lake Mungo machte.
Seine Hypothese der regionalen Kontinuität fordert das vermeintliche Alleinstellungsmerkmal Afrikas als Ursprung des modernen Menschen heraus und wirft neue Fragen über die Mobilität und Vielgestaltigkeit unserer frühen Vorfahren auf. Thornes Arbeit begann 1968 mit der spektakulären Entdeckung der „Mungo Lady“, deren verbrannte und zersplitterte Skelette Fragmente tief in verfestigtem Sand des ehemaligen Lake-Mungo-Sees enthielten. Die Arbeit, die Thorne im Anschluss über Monate vorsichtig und akribisch betrieben hat, gipfelte in der Rekonstruktion eines nahezu vollständigen Skeletts dieser frühen Australierin. Obwohl zunächst angenommen wurde, dass die „Mungo Lady“ nur etwa 25.000 Jahre alt sei, wiesen ihre zarten, beinahe eierhühnereierschalenartigen Knochen auf eine überraschende Unterschiedlichkeit zu anderen zuvor in Australien gefundenen, großwüchsigen, breitknochigen Fossilien hin.
Thorne war anfangs unsicher, doch die eigentliche Sensation folgte, als er sechs Jahre später den „Mungo Man“ in unmittelbarer Nähe entdeckte: ein ebenfalls filigraner, jedoch männlicher Skelettfund, der erst später auf ein Alter von rund 60.000 Jahren datiert werden konnte – doppelt so alt wie angenommen. Diese erstaunliche Altersbestimmung, erzielt durch neuartige Datierungsmethoden, erschütterte fundamentale Annahmen der out-of-Africa-Theorie. Die Vorstellung, dass Homo sapiens erst vor etwa 120.000 Jahren aus Afrika auszog, um sich weltweit auszubreiten, geriet ins Wanken, da nicht genügend Zeit bestand, um die weiten Strecken bis nach Australien zurückzulegen, sich anatomisch so grundlegend zu verändern, Boote zu entwickeln und so weiter.
Thorne schlug daher einen alternativen Weg vor: die Theorie regionaler Kontinuität. Nach dieser Sichtweise wanderten schon relativ frühe Menschenformate – als Homo sapiens verstanden – vor etwa zwei Millionen Jahren aus Afrika aus und verbreiteten sich über Eurasien hinweg, bevor sie sich in den unterschiedlichen Regionen weiterentwickelten. Die genetische Vielfalt und die physische Variation wurden so keine Folge eines einzigen Afrikaauszuges mit nachfolgender Auslöschung anderer Menschenlinien, sondern das Resultat eines kontinuierlichen, regional differenzierten Entwicklungsprozesses mit fortwährendem Genfluss zwischen Populationen. Das Konzept der regionalen Kontinuität bringt eine vielschichtigere Sicht auf die Variabilität der menschlichen Formen zum Ausdruck. Alan Thorne betont, dass es trotz äußerlicher Unterschiede innerhalb der verschiedenen Menschenfossilien entscheidend ist, dass alle zur selben Spezies gehören könnten, da sie sich theoretisch untereinander fortpflanzen und fruchtbare Nachkommen zeugen konnten.
Das mutet im ersten Moment kontrovers an, vor allem angesichts des klassischen Gesichts des Neandertalers oder des breiten Homo erectus-Schädels. Doch auch heutige Menschen zeigen eine erstaunliche Bandbreite an physischen Merkmalen – allein die Vielfalt von europäischen, afrikanischen und asiatischen Populationen veranschaulicht diesen Umstand. Ein weiterer Meilenstein in der Diskussion um Thornes Hypothese ergab sich aus der Analyse von mitochondrialer DNA (mtDNA) des „Mungo Man“. In Zusammenarbeit mit Genetikern wurde aus dessen Skelett das bisher älteste menschliche DNA-Material nachgewiesen. Die überraschende Erkenntnis daraus war, dass diese mtDNA keine Übereinstimmung mit der DNA zeitgenössischer Menschen, aber auch nicht mit der bekannten mtDNA africaner oder anderer populärer Linien zeigte.
Dieses Ergebnis widersprach den Vorhersagen der out-of-Africa-Anhänger klar. Wenn alle modernen Menschen außerhalb Afrikas aus einem gemeinsamen, relativ jungen afrikanischen Vorfahren stammten, hätte man erwartet, genau dort Übereinstimmungen zu finden. Kritiker konterten schnell, dass solche alten mtDNA-Sequenzen möglicherweise heute ausgestorben sind, sich also nicht in gegenwärtigen Populationen erhalten haben müssen. Zudem warfen sie Thorne vor, die Ergebnisse seien womöglich auf Kontamination zurückzuführen, da sie eine extrem hohe Erfolgsrate bei der DNA-Extraktion aus uralten Knochen zeigten – etwas, das selbst angesehenen Institutionen wie der Oxford University selten gelang. Dennoch weist Thorne darauf hin, dass mtDNA-Analysen nur einen Teil der genetischen Realität abbilden und dass sich die Evolution des Genoms ohnehin über Millionen von Jahren stetig vollzieht.
Die Kontroverse um die Besiedlung Australiens und die Herkunft der modernen Menschen erweitert sich damit auf globaler Ebene zu einer breiter geführten Debatte. Mit der regionalen Kontinuität detailliert Thorne eine zusammenhängende Entwicklung des Homo sapiens über rund zwei Millionen Jahre hinweg, während Out-of-Africa auf mehrere diskrete Migrationsereignisse setzt, bei denen frühe Menschenarten durch moderne Menschen ersetzt wurden. Thornes Standpunkt interpretiert die menschliche Evolution als fließenden Prozess mit einer Vielzahl von Populationen, die sich dauerhaft genetisch austauschten – auch dort, wo heute erscheinende Unterschiede die Menschen als separate Arten klassifizieren ließen. Diese Perspektive wird gestützt durch Vergleichsstudien anderer Säugetiere, bei denen Hybridisierung zwischen verschiedenen, formal als Arten geltenden Populationen fruchtbare Nachkommen hervorbringt. Beispiele wie Kreuzungen zwischen Wolf und Kojote oder verschiedenen Bärenarten zeigen, dass Starre in der Artdefinition oft erster Schritt zu einem Mangel an Verständnis der tatsächlichen biologischen Vielfalt sein kann.
Auch Darwin selbst stellte die Artbezeichnung als ein praktisches, aber nicht immer eindeutig abgrenzbares Konstrukt dar. Die kulturelle Dimension spielt bei Thornes Arbeit eine wichtige Rolle. Australien gilt als Kontinent einer der ältesten ununterbrochenen Kulturtraditionen der Menschheit – die der Aborigines. Thornes Nähe zu diesem kulturellen Umfeld, kombiniert mit seinen archäologischen Befunden, lässt ihn an mehrere Migrationswellen denken, bei denen asiatische Populationen – möglicherweise von unterschiedlichen Ursprüngen wie China oder Indonesien – ins Gebiet einwanderten, um sich schließlich zu vermischen. Seine Interpretation der Begräbnisrituale um Mungo Lady, welche zweifache Verbrennung und Zertrümmerung des Leichnams beinhalteten, verweist zudem auf komplexe kulturelle Praktiken und tief verwurzelte spirituelle Vorstellungen, die der archäologischen Sicht mancher moderner Forscher entgehen könnten.
Die Debatte ist nicht ohne politische und soziale Implikationen. In Australien beeinflussen Thornes Erkenntnisse den Umgang mit dem Erbe der Aborigines, da die Funde von Lake Mungo die Geschichte der frühen Besiedlung und die kulturelle Bedeutung der Region neu beleuchten. Es führte dazu, dass der Fundort offiziell als Nationalpark geschützt und das Gebiet schrittweise in die Verwaltung der Aborigines überführt wird, die über den Umgang mit den Artefakten und dem Land selbst bestimmen. Eine symbolträchtige Geste war die Rückgabe der originalen Überreste von Mungo Lady an die örtlichen Stämme, die sie im Gegensatz zu Thorne selbst zunächst weiter bewahren wollten – eine Entscheidung, die Raum für zukünftige Interpretationen und Forschungen lässt. Trotz aller Kontroversen bleibt Alan Thornes Sicht ein wichtiger Impulsgeber für das Wissenschaftsfeld.
Die Komplexität der genetischen Daten, die Vielfalt uralter menschlicher Fossilien und das Wachstum neuer Technologien zur Datierung und DNA-Analyse führen dazu, dass absolute Wahrheiten der Vergangenheit schwer fassbar bleiben. Thornes Herangehensweise fordert ein offenes sowie multidisziplinäres Verständnis der menschlichen Evolution, in dem evolutionäre Übergänge und vermischte Populationen stärker berücksichtigt werden. Der Diskurs, der durch die Funde von Lake Mungo und das Engagement Thornes ausgelöst wurde, ist exemplarisch für die Dynamik der Wissenschaft im Allgemeinen und der Anthropologie im Besonderen. Statt starrem Dogma entstehen neue Theorien, die die unendliche Vielfalt und die verzweigten Wege der menschlichen Geschichte anerkennen. Ob Thornes regionale Kontinuität letztlich das endgültige Modell darstellt, bleibt offen.
Der spannende Wettstreit zwischen Out-of-Africa und regionaler Entwicklung zeigt jedoch eindrücklich, wie Forscher mit jeder neuen Entdeckung unsere Ursprünge neu denken müssen – stets am Puls der Zeit, getragen von Skepsis, Leidenschaft und dem Drang, das Rätsel Menschheit immer weiter zu entschlüsseln.
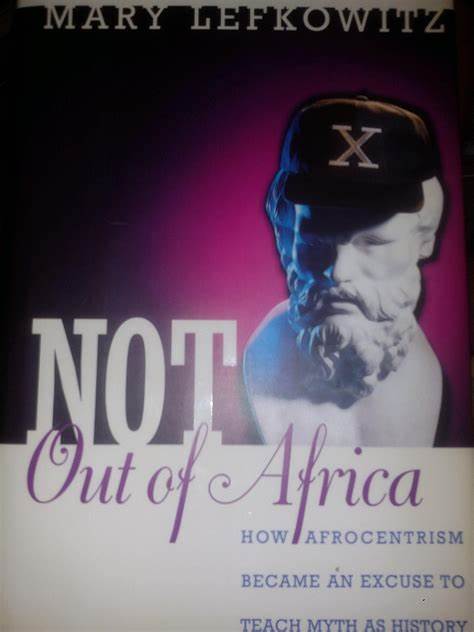



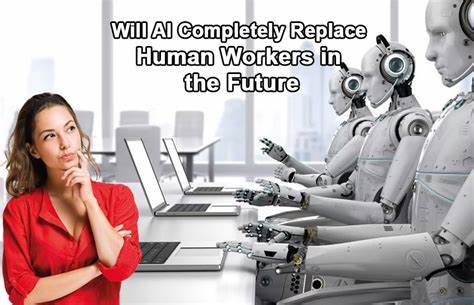
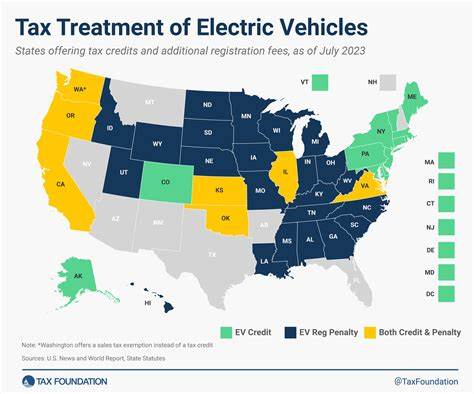
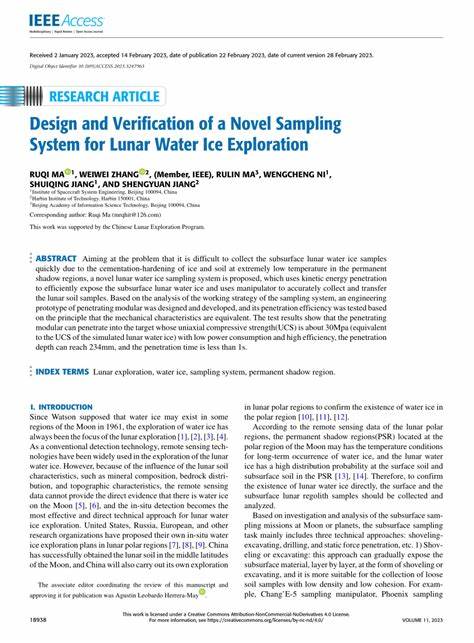

![Selling Subscriptions [pdf]](/images/E7B1622B-313A-48A0-B805-3029E53664D0)