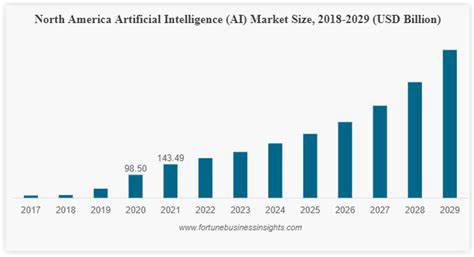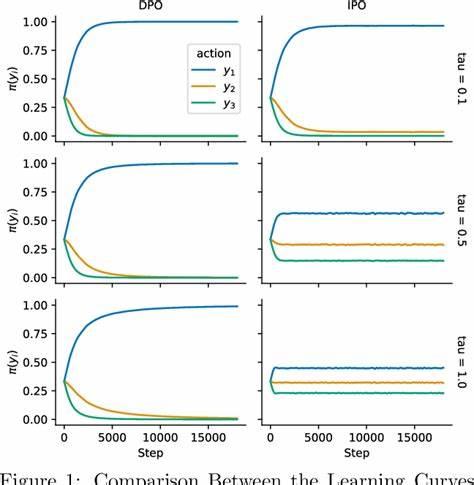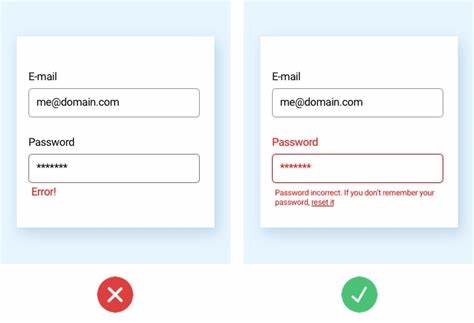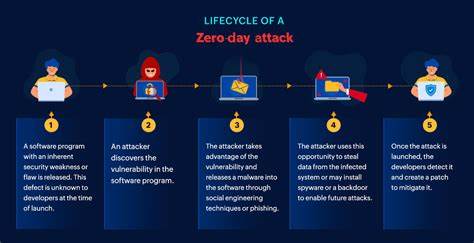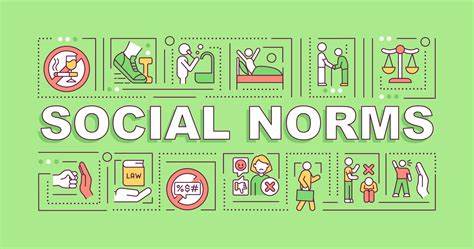In den letzten zwei Jahrzehnten ereignete sich in Schweden ein unerklärliches Phänomen, das die medizinische Welt vor ein Rätsel stellte: Kinder von Flüchtlingsfamilien, insbesondere aus Kriegs- und Krisengebieten, fielen in einen Zustand scheinbaren endlosen Schlafs. Diese Krankheit, die zunächst unverständlich schien, wurde schließlich als Resignationssyndrom oder auf Schwedisch „Uppgivenhetssyndrom“ bezeichnet – ein Zustand, der tiefste Apathie ausdrückt und zugleich die verzweifelte Kapitulation der betroffenen Kinder symbolisiert. Die Geschichte dieser Kinder und ihrer Familien ist nicht nur eine medizinische Herausforderung, sondern auch ein Spiegelbild der extremen Belastungen, die Kinder in Geflüchtetenfamilien erfahren. Das Resignationssyndrom betrifft vor allem Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sieben und neunzehn Jahren, die oft aus traumatisierten, von Krieg und Gewalt geprägten Herkunftsländern stammen. Häufig sind es Familien, die im Asylverfahren in Schweden stecken, deren Zukunft ungewiss und bedrückend ist.
Der Beginn der Erkrankung ist oft schleichend. Zunächst zeigen die Kinder Symptome wie Angst, Rückzug aus sozialen Kontakten und Depression. Sie brechen den Schulbesuch ab, hören auf zu sprechen und verlieren das Interesse an Spielen und anderen Aktivitäten, die zuvor Freude bereitet hatten. Mit der Zeit ziehen sie sich immer weiter zurück, bis sie schließlich regungslos im Bett liegen, die Augen geschlossen, vollkommen passiv und scheinbar ohne Bewusstsein. Die Betroffenen blieben über lange Zeiträume in diesem Zustand, oft über Monate oder sogar Jahre.
Klinische Untersuchungen nach Symptomen einer körperlichen Erkrankung oder neurologischen Störungen erbrachten keine greifbare Erklärung. Trotz des offensichtlichen kranken Zustands zeigten Gehirnscans und EEG-Aufzeichnungen normale Muster. Die Kinder verharrten in Tiefschlafpositionen, öffneten die Augen nur kaum, nahmen keine Nahrung zu sich, mussten künstlich ernährt werden, zeigten jedoch neurologisch keine Zeichen eines Komas oder anderer bekannter Zustände. Die Medizin stand vor einem Rätsel, und Jahre vergingen, ohne dass ein klarer Krankheitsmechanismus identifiziert werden konnte. Ein entscheidender Aspekt dieser Erkrankung ist, dass sie ausschließlich Kinder von asylsuchenden Familien betrifft.
Dieser Faktor lenkt die Aufmerksamkeit auf die psychologischen und sozialen Belastungen, die auf diesen Kindern lasten. Die betroffenen Familien haben häufig eine traumatische Flucht hinter sich, in der sie Krieg, Gewalt, Verlust und Verfolgung erlebt haben. Die Eltern und Kinder leben in ständiger Angst vor Abschiebung, Ablehnung und Rückkehr in unsichere Länder. Dieses Gefühl von Hoffnungslosigkeit und existenzieller Bedrohung kann zu extremen psychosomatischen Reaktionen führen. Eine tragische Geschichte einer Familie hilft, die Tragweite der Belastung zu verstehen.
Die Kinder Nola und Helan stammen aus einer yazidischen Familie, die im Bürgerkrieg in Syrien verstreut war, einem Volk, das seit Jahrzehnten unter massiver Verfolgung leidet. Die Mutter wurde vor Jahren auf grausame Weise verletzt, die Familie war innerhalb einer Umgebung voller Gewalt und Drohungen gefangen. Inmitten von Sprachbarrieren, bürokratischen Hürden und der Unsicherheit des Asylverfahrens lebten die Mädchen zunächst ein fast normales Leben in Schweden, bis die langwierigen Ablehnungen des Asylantrags den psychischen Druck auf die Familie erhöhten. Es folgte der schrittweise Rückzug der Kinder in den Kokon der Apathie, der sich schließlich als Resignationssyndrom manifestierte. Die medizinische Gemeinschaft sucht bis heute nach Erklärungen.
Biologisch lässt sich im Gehirn kein pathologischer Schaden erkennen, der diese tiefe körperliche Lethargie erklären könnte. Das Resignationssyndrom zeigt so den brüchigen Grenzbereich zwischen Körper und Geist, in dem psychosoziale Schmerzen physisch real und lähmend werden. Einige Wissenschaftler sehen Parallelen zum sogenannten Pervasive Refusal Syndrome, einem seltenen psychiatrischen Zustand, bei dem Kinder und Jugendliche aufhörten, zu essen, zu sprechen und zu interagieren. Beide Störungen sind mit massivem psychischem Stress verbunden, doch das Resignationssyndrom zeichnet sich durch einen noch tieferen Rückzug aus der Welt aus. Diese Kinder sind keineswegs „Simulanten“ oder „fälschlich Krankheitsvortäuschende“.
Vielmehr offenbart ihr Zustand die verzweifelte Kapitulation eines jungen Menschen, der den Kampf gegen unverständliche und zerstörerische Umstände aufgibt. Die neurologische Normalität in Tests widerspricht der subjektiv inakzeptablen Realität der Kinder, die sich in einem sogenannten „Endlosschlaf“ befinden, der eher einer Apathie nahekommt, einer Abwendung von der eigenen Existenz. Die gesellschaftlichen Konsequenzen sind gravierend. Oftmals werden die psychisch vermittelten Erkrankungen nicht mit der nötigen Empathie und Unterstützung behandelt, da sie „unsichtbar“ sind und keine klaren pathologischen Befunde präsentieren. Die Familien werden mit Vorurteilen und Misstrauen konfrontiert, da funktionelle und psychosomatische Erkrankungen häufig stigmatisiert werden.
Aus diesem Grund fordert das Phänomen des Resignationssyndroms die medizinische Gemeinschaft heraus, auch den seelischen Schmerz von Traumatisierten als legitime Ursache schweren Leidens anzuerkennen. Darüber hinaus wirft das Resignationssyndrom ein Schlaglicht auf die Verantwortung moderner Gesellschaften und das Asylsystem. Die traumatischen Erfahrungen, die zentrale Faktoren für diese Krankheit sind, lassen sich nicht einfach in Krankenhäusern heilen. Die Kinder sind Teil eines größeren sozialen Problems, verbunden mit Krieg, Vertreibung, sozialer Isolation und existentiellem Verlust. Ohne eine umfassende Fürsorge, die psychische Gesundheit, sozialen Schutz und langfristige Integration in den Mittelpunkt stellt, ist Heilung kaum vorstellbar.
Eine besondere Bedeutung haben dabei die Beziehungen in der Familie und das soziale Umfeld. Einige Experten gehen davon aus, dass auch die psychische Situation der Eltern, vor allem der Mütter, das Risiko für das Resignationssyndrom erhöht. Eltern, die selbst unter einer großen Last emotionaler Traumata leiden, können möglicherweise nicht die emotionale Sicherheit bieten, die Kinder brauchen, um mit Stressoren umzugehen. Diese „lethale Mutterrolle“ beschreibt einen Zustand, in dem die existenzielle Angst der Eltern auf die Kinder übertragen wird, bis diese ihre Umwelt völlig abwenden. Dennoch überwiegt die Hoffnung auf Heilung.
In einigen Fällen haben Kinder nach intensiver und ganzheitlicher Betreuung, die physische Pflege, psychologischen Beistand und eine stabile, sichere Umwelt umfasste, den Rückweg aus dem Resignationssyndrom geschafft und begannen langsam wieder zu sprechen, zu essen und sich zu bewegen. Diese Prozesse benötigen Zeit, viel Geduld und vor allem das Angebot von Schutz und Zugehörigkeit. Das Resignationssyndrom erinnert uns an die komplexen Verbindungen zwischen Psyche und Körper und an die immensen Folgen sozialer und politischer Umstände auf das Individuum. Es ist ein Aufruf dazu, sensibel und kritisch mit den Geschichten und Leiden von Flüchtlingskindern umzugehen, die oft das Unsichtbare tragen. Mehr als medizinische Diagnostik bedarf es eines tiefen Verständnisses für Trauma, kulturellen Kontext und sozialpolitische Faktoren, um diesen Kindern den Weg zurück ins Leben zu erleichtern.
Ein wichtiger Aspekt ist die Notwendigkeit, Resignationssyndrom als ernstzunehmende Krankheit gesellschaftlich und medizinisch anzuerkennen und den betroffenen Familien umfassende Unterstützung zu bieten. Die Kombination aus psychischer Traumatisierung, psychischen Erkrankungen und sozialen Stressoren fordert ein Umdenken in der Versorgung von asylsuchenden Familien, das weit über konventionelle medizinische Maßnahmen hinausgeht. Während die Forschung fortschreitet, bleibt das Resignationssyndrom ein Symbol für das Leiden einer durch Krieg und Flucht gezeichneten Generation. Diese Kinder sind keine „Fälle“, sondern Menschen, die die äußersten Grenzen von Körper und Geist erfahren. Ihre Geschichte zeigt auf bedrückende Weise, wie sehr politische Entscheidungen und gesellschaftliche Haltungen das Leben einzelner Menschen und ihre Gesundheit bestimmen können.
Die Erforschung dieser Erkrankung berührt grundlegende Fragen der Medizin und Psychologie: Wie erfassen wir den Zusammenhang zwischen Trauma und Körper? Inwieweit definiert sich Gesundheit über sichtbare Biomarker? Und welche Rolle spielt gesellschaftlicher Schutz und Zugehörigkeit für die Heilung psychisch bedingter Leiden? Zusammenfassend verlangt das Resignationssyndrom nicht nur nach medizinischer Klärung, sondern auch nach Empathie, politischem Engagement und einem erweiterten Verständnis des menschlichen Leids. Nur durch ganzheitliche Ansätze, die körperliche, psychische und soziale Dimensionen integrieren, kann diesen Kindern geholfen werden, aus dem endlosen Schlaf zu erwachen und wieder ein Leben voller Hoffnung führen zu können.