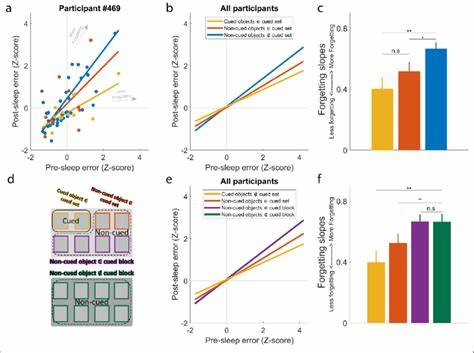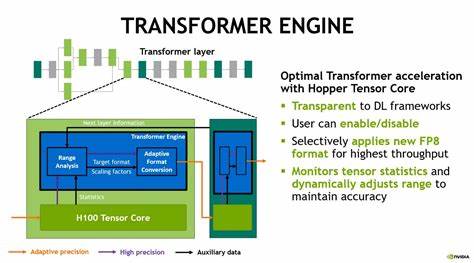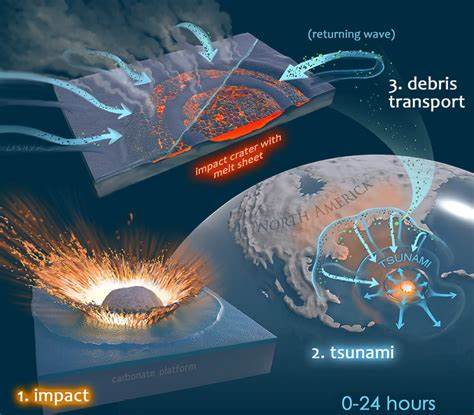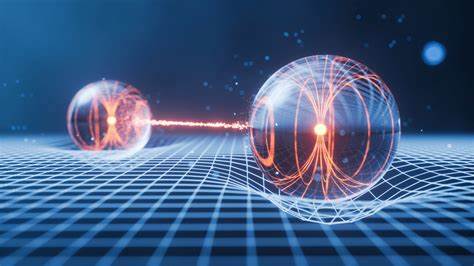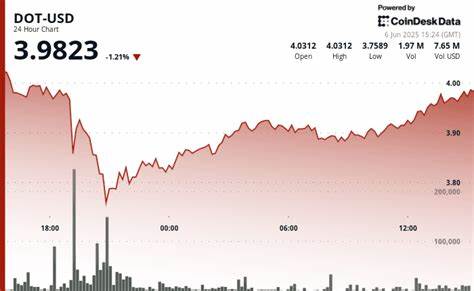Der Fintech-Riese Wise hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Wachstumsphase hingelegt, die das Unternehmen zu einem bedeutenden Akteur innerhalb der Finanztechnologiebranche gemacht hat. 2021 startete Wise mit großem Optimismus an der Londoner Börse, unterstützt von seiner schnellen Expansion und der Hoffnung, den britischen Fintech-Standort zu stärken. Nun kündigt das Unternehmen den Wechsel seiner Hauptnotierung von London nach New York an. Dieses Manöver wirft nicht nur ein Schlaglicht auf die internationale Kapitalmarktstrategie, sondern auch auf die heiß diskutierte Frage der Stimmrechtsverteilung innerhalb des Unternehmens und ihrer zukünftigen Ausgestaltung. Im Zentrum steht die Entscheidung des Gründers Kristo Käärmann, dessen sogenannte „supercharged voting rights“ in Großbritannien bald auslaufen könnten.
Wird das Mehrheitsvotum fortbestehen, wenn das Unternehmen seinen primären Börsenplatz in die USA verlegt? Und was bedeutet das für die Zukunft der Fintech-Szene im Vereinigten Königreich? Diese Fragen sind für Investoren, Marktbeobachter und politische Entscheidungsträger gleichermaßen von hoher Relevanz. Wise startete mit einer dualen Aktienstruktur an der Londoner Börse, die es Gründern ermöglichte, sich durch spezielle Stimmrechtsklassen größere Einflussmöglichkeiten im Unternehmen zu sichern. Konkret bedeutet dies, dass der Gründer zwar rund 18 Prozent der Anteile hält, aber über 50 Prozent der Stimmrechte verfügt. Während solche Stimmrechtsarrangements in den USA, vor allem bei Technologietiteln, keine Seltenheit und weithin akzeptiert sind, gelten sie in Großbritannien als umstritten und stehen unter besonderer Beobachtung der Regulierungsbehörden und Anleger. Um diesem Konflikt Rechnung zu tragen, wurde bei der damaligen Börsenzulassung eine „Sunset Clause“ vereinbart.
Diese Auslaufklausel sieht eine Begrenzung der Mehrheitsrechte des Gründers über einen vorher definierten Zeitraum vor, konkret bis zum Sommer 2026. Die Idee dahinter war es, Startups mit innovativen Geschäftsmodellen und starken Gründungsteams zu motivieren, sich in London zu listen, während zugleich Investoren geschützt und langfristig eine gerechtere Stimmrechtsverteilung gewährleistet wird. Die Entscheidung von Wise, nun den Schwerpunkt der Börsennotierung in die USA zu verlegen, könnte diesen Balanceakt jedoch auf den Kopf stellen. In den Vereinigten Staaten ist die Praxis, dass Gründer mit reduziertem Kapitalanteil dennoch hohe Mitsprache- und Kontrollrechte behalten, weit stärker institutionalisiert und akzeptiert. Führende Tech-Unternehmen wie Alphabet oder Facebook praktizieren ähnliche Unterschiede in der Stimmrechtsgewichtung, um Gründern die Zeit und die Kontrolle zu sichern, ihre Vision umzusetzen.
Wise hat in einer Stellungnahme betont, dass die neue US-Notierung eine „Struktur aufweist, die mit den Marktpraktiken in den USA und den dort gelisteten Tech-Peers übereinstimmt“. Dies lässt vermuten, dass Käärmann langfristig die Fortsetzung seiner erweiterten Stimmrechte anstrebt, womit die bislang in London geltende Auslaufklausel obsolet werden könnte. Aus Sicht der Unternehmensführung eröffnet die Verlegung der Hauptnotierung in den US-Markt bedeutende Wachstumspotenziale. Wise strebt eine größere Reichweite bei Investoren an sowie die Aufnahme in wichtige US-Aktienindizes, etwa den S&P 500 oder Nasdaq, was die Sichtbarkeit und die Liquidität der Aktie erhöht. Allerdings positioniert sich das Unternehmen dadurch in einem hochkompetitiven Umfeld, in dem es gegen Schwergewichte mit oft dreistelligen Milliardenbewertungen wie Nvidia, Apple oder Microsoft antreten muss.
Internationaler Wettbewerb ist für Wise also eine Herausforderung, bedeutet aber gleichzeitig einen Schritt hin zu größerer Globalisierung und etablierten Anlegergruppen. Die Folgen für den britischen Finanzplatz sind dennoch deutlich spürbar. Der Verlust der Hauptnotierung eines so bedeutenden Fintech-Unternehmens wie Wise gilt als Rückschlag für den Standort London, der sich bemüht, nach dem Brexit seine Attraktivität für Technologiefirmen und internationale Investoren zu stärken. Insbesondere die Entscheidung, trotz der Zulassung von Dual-Class-Strukturen bei britischen Börsen nicht in den FTSE-Indices gelistet zu sein, wirft Fragen auf: Warum hat Wise bisher nicht den Zugang zu diesen wichtigen britischen Indizes gesucht, obwohl die Voraussetzungen mittlerweile vorhanden sind? Die derzeit in Großbritannien geltenden Regelungen erlauben die Aufnahme von Unternehmen mit dualen Stimmrechtsklassen unter der Bedingung, dass eine Sunset-Klausel existiert. Dies sollte ein Mittel sein, den Gründern ausreichend Einfluss zu sichern und gleichzeitig die Bedenken von Fondsmanagern und institutionellen Anlegern zu lindern.
Doch die angekündigte Verlegung der Hauptnotierung wirft die Frage auf, ob diese Kompromisse tatsächlich ausreichen, um große Tech-Startups im Land zu halten. Die steuerlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen in Großbritannien, wie der relativ hohe Stempelsteuer-Zuschlag auf Aktienkäufe und eine gewisse Zurückhaltung bei der Umsetzung innovativer Marktmechanismen, werden immer wieder als wettbewerbshemmend wahrgenommen. Insbesondere im Vergleich mit den deutlich liquideren amerikanischen Märkten scheint London an Attraktivität zu verlieren. Für den Gründer Käärmann wiederum steht viel auf dem Spiel. Die erweiterten Stimmrechte erlauben ihm, die strategische Ausrichtung und das Management über einen längeren Zeitraum maßgeblich zu bestimmen, was für die Entwicklung von Technologieunternehmen oft entscheidend ist.
Dennoch birgt eine Übertragung dieser Rechte in die amerikanische Struktur Risiken, etwa durch eine stärkere Regulierung in den USA oder durch veränderte Erwartungen und Anforderungen amerikanischer Investoren. Die formelle Entscheidung über die zukünftige Aktienstruktur wird in einer Aktionärsbeteiligungskampagne parallel zur Umstellung auf die US-Notierung erwartet. Dann wird sich zeigen, ob Wise tatsächlich die „Sunset Clause“ in Großbritannien sukzessive ablöst und in den USA eine dauerhafte Struktur mit gleichbleibend mächtigen Gründerrechten etabliert. Die Situation zeigt exemplarisch den globalen Wettbewerb zwischen Finanzplätzen um die Ansiedlung innovativer Unternehmen und das Spannungsfeld zwischen Gründerkontrolle und Aktionärsschutz. Für die Zukunft des Fintech-Sektors bietet der Schritt von Wise wertvolle Einblicke: Der Kapitalmarkt muss attraktive und flexible Rahmenbedingungen schaffen, um Gründer mit visionären Geschäftsmodellen anzuziehen – gleichzeitig aber auch das Vertrauen breiter Anlegerkreise sichern.
Die Entwicklungen in den nächsten Monaten werden zeigen, ob London in der Lage ist, diese Gratwanderung zu meistern oder ob es langfristig noch weitere prominente Abwanderungen geben wird. Wise ist neben vielen anderen Unternehmen ein Gradmesser für die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des UK-Fintech-Ökosystems. Neben der reinen Börsenplatzfrage steckt auch eine wichtige Debatte um Governance, Transparenz und Beteiligungsrechte hinter der Nachricht. Die Antworten, die Wise findet, können auch andere Startups und Investoren inspirieren und maßgeblich beeinflussen, wie Gründerkontrolle im digitalen Zeitalter gestaltet wird. Zusammenfassend sind die Pläne von Wise mehr als bloße Standortfragen: Sie spiegeln eine sich wandelnde Unternehmenslandschaft wider, in der internationale Kapitalmärkte, Technologieentwicklung und Aktionärsinteressen komplex miteinander verwoben sind.
Für Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft ist es deshalb essenziell, die Rahmenbedingungen entsprechend weiterzuentwickeln, um langfristig eine attraktive Heimat für Fintech- und Technologieunternehmen zu bieten – ganz gleich, ob dies in London, New York oder anderswo geschieht.