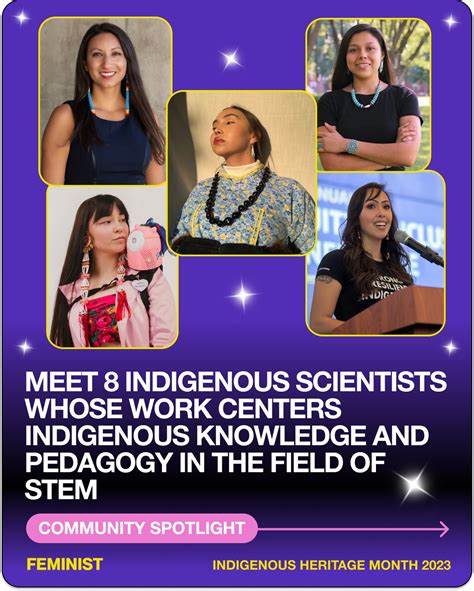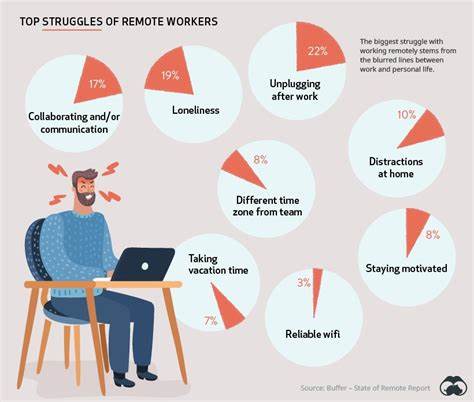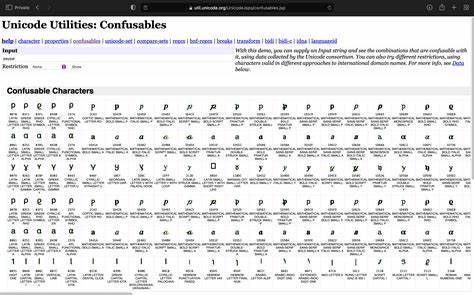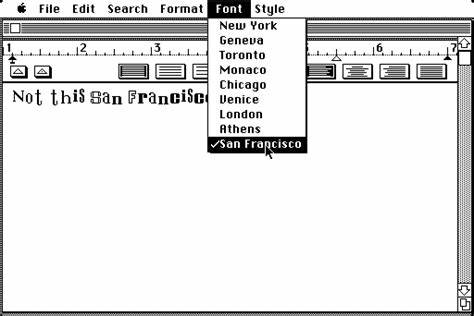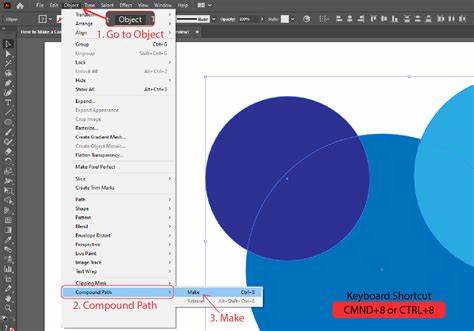Indigene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler befinden sich gegenwärtig an vorderster Front eines bedeutenden und oft unterschätzten Kampfes: dem Schutz ihrer Daten und damit der Bewahrung ihrer kulturellen Identität und Rechte. In einer Zeit, in der politische Veränderungen, technologische Übergriffe und historische Ungerechtigkeiten zusammenkommen, gewinnt das Thema „indigene Datenhoheit“ zunehmend an Bedeutung. Für viele indigene Gemeinschaften geht es dabei nicht nur um den Schutz von Informationen, sondern um die Aufrechterhaltung ihrer Autonomie, ihres Wissens und ihres kollektiven Erbes. Die politischen Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahren mitunter stark verändert. Besonders während der Trump-Administration in den USA kam es zu erheblichen Einschnitten bei Fördermitteln für indigene Forschende und zu einer steigenden Unsicherheit hinsichtlich des Umgangs mit sensiblen Daten.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler berichteten von existenziellen Sorgen über ihre Karriere, den Verlust von Forschungsgeldern und die Bedrohung der Öffentlichkeit zugänglichen Informationen, die wiederum unmittelbar mit den Lebenswelten indigener Völker verbunden sind. Der Zusammenhang zwischen staatlicher Gewalt und der Kontrolle von Daten ist dabei kein neues Phänomen, sondern ein Teil einer langen Geschichte von kolonialer Ausbeutung und systematischer Unterdrückung. Die Geschichte indigener Rechte und die Datenhoheit sind untrennbar miteinander verknüpft. Seit der kolonialen Ära, also seit 1492, wurden Informationen über indigene Gemeinschaften und deren Wissen häufig ohne Zustimmung gesammelt, oft missbraucht und oftmals dazu genutzt, indigene Interessen zu untergraben. Die Sammlung von Daten über Umwelt, Sprache, traditionelle Praktiken oder genealogische Informationen geschah meist einseitig und ohne wirkliche Einbindung der Gemeinschaften, deren Daten betroffen waren.
Der Missbrauch reichte vom Diebstahl kultureller Artefakte bis zur Privatisierung von geistigem Eigentum. Datenhoheit, auch als „Indigenous Data Sovereignty“ bezeichnet, hat als Bewegung ihren Ursprung in der Forderung nach einem eigenen Recht indigener Völker über die Verwaltung und den Zugang zu ihren Daten zu verfügen. Es geht darum, nicht länger als bloße Objekte von Wissenschaft behandelt zu werden, sondern als aktive Partner mit einem Recht auf Selbstbestimmung in Fragen der Datenerhebung, -speicherung und -nutzung. Indigene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler betrachten sich nicht nur als Hüterinnen und Hüter des Wissens, sondern als Expertinnen und Experten auf ihrem Gebiet, deren Perspektiven und Bedürfnisse respektiert werden müssen. Die technische Dimension ist hierbei eine wichtige, aber nicht allein entscheidende Komponente.
Der Aufbau sicherer, zugriffsgeschützter Server, häufig in Ländern wie Kanada oder Europa, ist Teil der Strategie, um Daten vor unbefugtem Zugriff durch staatliche Institutionen oder große Tech-Konzerne zu schützen. Anbieter wie CryptPad oder Sync bieten sichere Alternativen zu US-amerikanischen Cloud-Diensten, deren Kooperation mit staatlichen Stellen und deren interne Politik gegenüber indigenen Daten oftmals kritisch betrachtet werden. Gleichzeitig arbeiten indigene Unternehmerinnen und Unternehmer wie Angie Saltman mit eigenen Datenzentren und Strukturen, die es erlauben, Daten nach den Prinzipien der Gemeinschaft zu verwalten und vor Fremdkontrolle zu schützen. Doch die Sicherung der Infrastruktur allein reicht nicht aus. Indigene Datenhoheit ist ein tiefgründiger gesellschaftlicher und kultureller Prozess, der auch die Neuorientierung in wissenschaftlichen Methoden und in der Beziehung zwischen Forschenden und Gemeinschaften beinhaltet.
Vertrauen steht hier im Zentrum – Vertrauen zwischen unterschiedlichen Kulturen, Forschungseinrichtungen und den Gemeinschaften, die dieses Wissen betreffen. Viele indigene Forscherinnen und Forscher betonen die Bedeutung der Wiederherstellung dieses Vertrauens und die Notwendigkeit, koloniale Denkmuster zu überwinden, die auch in akademischen Institutionen noch tief verankert sind. Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Ausbildung der nächsten Generation indigener Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Indigenes Wissen und indigene Perspektiven müssen weiterhin anerkannt, dokumentiert und weitergegeben werden – und zwar unter Kontrolle derjenigen, denen es gehört. Historisch genutzte Methoden wie die Marshall’schen Stick-Karten beispielsweise zeigen, wie indigene Völker schon lange vor der modernen Wissenschaft Systematisierung und Datenmanagement betrieben haben.
Dieses Wissen verdient Respekt, Anerkennung und vor allem Selbstverwaltung. Verschiedene Universitäten und Forschungseinrichtungen setzen bereits konkrete Maßstäbe, um indigene Datenrechte zu respektieren. Dazu gehören beispielsweise Vertragsvorlagen, die explizit festhalten, dass indigene Gemeinschaften Eigentümer und Nutznießer ihrer Forschungsdaten sind. Eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, geprägt von gegenseitigem Respekt und einer auf Verträgen basierenden gemeinsamen Datenhoheit, stellt den Anspruch an eine gerechtere Wissenschaft. Ein anderer bedeutender Treiber in diesem Gebiet ist der Klimawandel, der für indigene Gemeinschaften existenzielle Bedrohungen mit sich bringt.
Der Verlust von Umweltkeimbeständen, Veränderungen im Verhalten von Tier- und Pflanzenarten sowie die Zunahme von Naturkatastrophen haben direkte Auswirkungen auf Lebensweisen, Gesundheit und kulturelle Praxis. Die Verfügbarkeit und Kontrolle von Umwelt- und Klimadaten sind daher unerlässlich, um adaptive Strategien zu entwickeln und ihre Gemeinschaften zu schützen. Projekte, bei denen orale Überlieferungen, traditionelle Wissensbestände und wissenschaftliche Daten zusammengeführt werden, demonstrieren die Stärke indigener Ansätze und betonen zugleich das Recht indigener Gemeinschaften darauf, selbst über diese Daten zu verfügen. Die Partnerschaften und internationalen Kooperationen zwischen indigenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern rund um die Welt sind beeindruckend und stärken die Bewegung zusätzlich. Netzwerke wie IndigeLab oder globale Konferenzen in Australien und Neuseeland verdeutlichen, dass indigene Datenhoheit ein globales Anliegen ist, das kulturelle, politische und technologische Grenzen überwindet.
Die Zusammenarbeit ermöglicht es, Expertise zu bündeln, voneinander zu lernen und gemeinsame Strategien zu entwickeln, um die Rechte und das Wissen indigener Gemeinschaften weltweit zu schützen. Die politische Landschaft bleibt allerdings unsicher. Die Streichung von Personalstellen, der Abbau von Kontakten innerhalb staatlicher Institutionen und finanzielle Kürzungen stellen eine andauernde Herausforderung dar. Dennoch zeigen Entwicklungen wie neue staatliche Abkommen in Bundesstaaten der USA beispielhaft, dass es auch Fortschritte gibt. Direkt zugängliche Gesundheitsdaten für indigene Gemeinschaften oder die Schaffung von Gesetzen, die den Schutz indigener Daten regeln, stärken langfristig die Position indigener Völker.
Die Rolle der Gesetzgebung wird somit immer relevanter. Innovative Ansätze, wie die Ausarbeitung von eigenen Gesetzen zum Schutz von indigenem Wissen – beispielsweise durch das Data Warriors Lab bei der Northern Cheyenne Nation – zeigen neue Wege auf, wie indigene Gemeinschaften das bestehende Rechtssystem nutzen, um sich zu schützen. Dabei geht es häufig darum, gesetzliche Hürden abzubauen, den Zugang zu relevanten Daten zu sichern und ein nachhaltiges Management von Wissen zu etablieren. Insgesamt ist der Kampf um indigene Datenhoheit ein vielschichtiger Prozess, der technologische, rechtliche, kulturelle und politische Dimensionen umfasst. Es geht darum, die Kontrolle über Daten nicht als isoliertes Thema zu verstehen, sondern als Bestandteil eines umfassenden Selbstbestimmungsrechts indigener Völker.
Diese Bewegung verbindet ein starkes Bewusstsein für historische Ungerechtigkeiten mit Hoffnung und einer aktiven Gestaltung einer gerechteren und respektvolleren Zukunft. Die Sicherung indigener Daten und Kulturen ist daher kein bloß technisches Problem, sondern eine fundamentale Frage von Macht, Gerechtigkeit und Respekt. Indigene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zeigen eindrücklich, wie alter und neuer Wissensschatz in einer digitalisierten Welt bewahrt und geschützt werden kann. Ihr Engagement hilft, den Blick für Vielschichtigkeit zu schärfen, während sie ihre Kultur und ihr Erbe verteidigen – und damit ein bedeutendes Kapitel der globalen Wissenschaftsgemeinschaft neu schreiben.