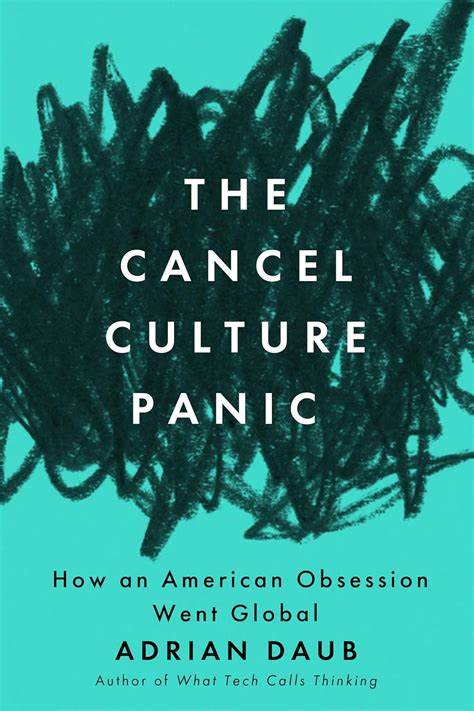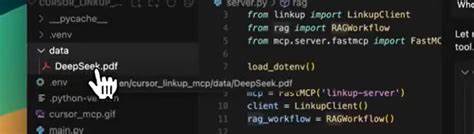Die Diskussion um die sogenannte Cancel Culture hat sich in den letzten Jahren zu einem weltweiten Phänomen entwickelt, das weit über die amerikanischen Grenzen hinaus Beachtung findet. Ursprünglich ein Begriff, der vor allem in den sozialen Medien der USA geprägt wurde, beschreibt Cancel Culture eine Form des sozialen und kulturellen Ausschlusses – das öffentliche Ächten oder Boykottieren von Personen oder Institutionen, die als moralisch oder politisch fragwürdig betrachtet werden. Doch die heutige Debatte offenbart nicht nur eine amerikanische Spezialität, sondern vielmehr eine globale Panikmache, die tief in den gesellschaftlichen Errungenschaften, Ängsten und politischen Spannungen unserer Zeit verwurzelt ist. Adrian Daub, renommierter Professor und Autor, bietet in seinem Werk „The Cancel Culture Panic: How an American Obsession Went Global“ eine faszinierende Analyse dieses Phänomens, die sowohl historische als auch kulturvergleichende Perspektiven einbezieht. Dabei zeigt er, dass die Panik um Cancel Culture weniger mit der Realität der Vorwürfe zu tun hat als mit den Ängsten einer liberalen Gesellschaft, die im Umbruch begriffen ist und sich zunehmend bedroht sieht.
Die ersten Spuren der Cancel-Culture-Diskussion lassen sich vor allem in akademischen Institutionen der Vereinigten Staaten finden, wo Debatten über politische Korrektheit, Meinungsfreiheit und politische Identität schon seit Jahrzehnten geführt wurden. Campusanekdoten über verunglückte Gastvorträge, Proteste gegen kontroverse Inhalte oder den Ruf nach „Safe Spaces“ sind Teil dieses langjährigen Diskurses. Doch was hier als Streit um akademische Freiheit und Vielfalt begann, entwickelte sich bald zu einem Symbol für einen breiteren kulturellen Konflikt, der die gesamte Gesellschaft betrifft. Adrian Daub zeigt auf, dass die Idee des „Cancelns“ – des Ausgrenzens und Verbannens – nicht neu ist. Historisch betrachtet hat es ähnliche moralische Paniken immer wieder gegeben, die aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten heraus entstanden sind.
Was heute jedoch auffällt, ist, wie die Sorge um Cancel Culture von verschiedenen Seiten politisch instrumentalisiert wird. Überraschenderweise sind es oft nicht nur konservative Stimmen, die vor einem vermeintlichen Verlust der Meinungsfreiheit warnen, sondern auch medial geprägte und oft als links geltende Kreise, die den Begriff maßgeblich definieren und verbreiten. Die weltweite Verbreitung des Diskurses ist ebenfalls bemerkenswert. Medien in Europa, Südamerika, Russland oder Australien haben die Debatten um Cancel Culture aufgegriffen und lokal adaptiert. Dabei entstehen eigene Narrative, die oftmals auf den jeweiligen gesellschaftlichen Konflikten basieren.
So manifestiert sich etwa in Frankreich eine heftige Debatte gegen das, was unter dem Schlagwort „le wokisme“ zusammengefasst wird, während Großbritannien und Deutschland ihre Varianten von „cancel culture“ mit einer Mischung aus Empörung und Sorge reflektieren. Interessanterweise basieren viele dieser Narrative auf amerikanischen Vorlagen und werden in ihren jeweiligen Kontexten weiterentwickelt und instrumentalisiert. Ein wichtiger Aspekt in Daubs Analyse ist die Rolle der Medien und deren Beitrag zur Entstehung und Verbreitung der Cancel-Culture-Panik. Gerade westliche Nachrichtenmedien, aber auch soziale Medien spielen eine entscheidende Rolle bei der Konstruktion des „Problems“. Die mediale Berichterstattung neigt dazu, Einzelfälle herauszugreifen und als repräsentativ für ein generelles gesellschaftliches Problem darzustellen.
Durch diese Dynamik entsteht ein Umwelt des Misstrauens, in der der Begriff Cancel Culture zu einem Kampfbegriff wird – ein Symbol für die angeblich gefährdete Meinungsfreiheit und kulturelle Identität. Die politische Dimension darf dabei nicht unterschätzt werden. In einer Zeit, in der populistische Bewegungen weltweit erstarken und gesellschaftliche Gräben tief erscheinen, fungiert die Panik um Cancel Culture als kulturelle Frontlinie. Vor allem konservative Kräfte nutzen sie, um „linke Kulturen“ und progressive politische Akteure anzugreifen, während diese wiederum versuchen, sich gegen Vorwürfe zu verteidigen, die oft übertrieben oder verfremdet sind. Somit ist Cancel Culture weniger eine objektiv messbare Realität, sondern eher ein Ausdruck gesellschaftlicher Unsicherheit und kultureller Konflikte.
Es ist zudem interessant, die psychologischen Facetten dieser Entwicklung zu betrachten. Die Angst vor dem „Abgestraftwerden“ oder „Ausgeschlossenwerden“ berührt ein tiefes menschliches Bedürfnis nach Anerkennung und sozialer Sicherheit. Die Vorstellung, dass eine falsche Äußerung oder ein überholtes Verhalten den eigenen sozialen und beruflichen Abstieg bedeuten könnte, erzeugt bei vielen Menschen ein Gefühl von Alarmbereitschaft und Vorsicht. So entsteht ein Klima, in dem Sorgfalt und Selbstzensur oft mit echtem oder vermeintlichem gesellschaftlichem Druck verschmelzen. Was bedeutet das für Universitäten als ein besonderer Schauplatz dieser Konflikte? Daub beschreibt, wie amerikanische Hochschulen zu Symbolen für die kulturellen Spannungen geworden sind, die Cancel Culture repräsentiert.
Sie sind Orte der Forschung, Bildung und freien Meinungsäußerung, zugleich aber auch Brennpunkte von Protesten, politischen Kämpfen und Medienaufmerksamkeit. Die internationale Öffentlichkeit blickt gespannt auf diese Institutionen, deren innerer Diskurs zunehmend politisiert und mythologisiert wird. Ein weiterer bemerkenswerter Punkt ist der Vergleich mit früheren sozialen und moralischen Paniken. Wie bei vergangenen Phänomenen – etwa den Hexenverfolgungen, der Kommunistenjagd in den USA oder den Kulturkämpfen der 1960er Jahre – wird auch heute die Angst vor gesellschaftlichem Wandel und gruppenbezogener Machtverschiebung sichtbar. Immer wieder zeigen sich Muster, bei denen ein vermeintliches „Böse“ zum Sündenbock gemacht wird, um größere Ängste zu kanalisieren und gesellschaftlichen Zusammenhalt wiederherzustellen.
Daubs Buch ist daher ein wertvoller Beitrag, um die Komplexität des Themas zu verstehen und die oftmals polarisierenden Debatten zu versachlichen. Die Erkenntnis, dass die Cancel-Culture-Panik nicht unbedingt auf realen Bedrohungen beruht, sondern auf einer kollektiven Angst vor Veränderung und Identitätsverlust, könnte helfen, den Dialog zwischen gesellschaftlichen Gruppen zu fördern. Ein reflektierter Umgang mit der Thematik dürfte es ermöglichen, die Chancen auf eine inklusive Gesellschaft zu erhöhen, ohne zugleich in eine kulturelle Überempfindlichkeit oder Ideologie abzurutschen. Gleichzeitig zeigt sich, dass die globale Verbreitung der Cancel-Culture-Debatte ein Zeichen für die zunehmende Vernetzung der Gesellschaften ist. Ideen und Ängste verbreiten sich rasch, entwachsen dem lokalen Kontext und führen zu internationalen Kulturkämpfen, die vielfach miteinander verwoben sind.
Die Herausforderung besteht darin, diese Dynamiken nicht als bloße Medienhysterie abzutun, sondern die dahinterliegenden Ursachen ernsthaft zu analysieren und an den gesellschaftlichen Grundfesten zu arbeiten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Panic um Cancel Culture ein komplexes Phänomen ist, das weit über eine episodische Medienwelle hinausgeht. Es steht exemplarisch für die kulturellen Spannungen des 21. Jahrhunderts, in denen Identität, Macht und gesellschaftlicher Wandel intensiv verhandelt werden. Wer diese Debatte verstehen möchte, sollte den analytischen und global vergleichenden Zugang wählen, den Adrian Daub in seinem Werk aufzeigt.
Nur durch differenzierte Betrachtungen können Polarisierungen aufgeweicht und neue Wege für ein konstruktives gesellschaftliches Miteinander gefunden werden.