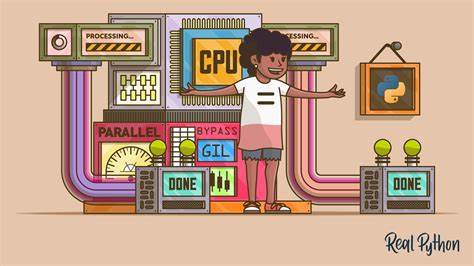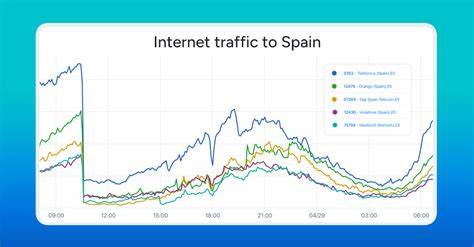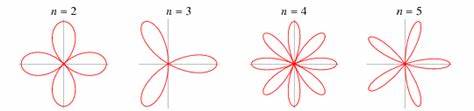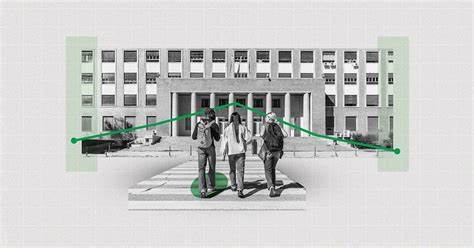In den vergangenen Jahrzehnten hat sich das Bild des Studierenden am Campus dramatisch gewandelt. Während man früher annahm, dass das Studium den Großteil der Tageszeit eines Studenten ausmacht, legen aktuelle Untersuchungen nahe, dass dies keineswegs der Fall ist. Das gängige Bild vom fleißigen, lernenden Studenten, der Stunden mit Lesen und Schreiben verbringt, entspricht heute kaum noch der Realität. Moderne Studierende widmen einen überraschend geringen Anteil ihrer Zeit dem Lernen, während Freizeit, soziale Aktivitäten und andere Engagements eine weitaus größere Rolle spielen. Diese Entwicklung wirft Fragen auf: Was sind die Gründe für diese Verschiebung? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für den Bildungsauftrag der Hochschulen? Und wie könnten Institutionen diese Situation zukünftig bewältigen und verbessern? Die zunehmende Aufmerksamkeit auf diese Fragen ist gerade angesichts steigender Studiengebühren, niedriger Abschlussquoten und der Kritik an der Qualität der akademischen Arbeit von zentraler Bedeutung.
Zunächst fällt auf, dass die durchschnittliche Zeit, die Studierende für das Studium aufwenden, seit Jahrzehnten kontinuierlich abnimmt. Vergleichsdaten aus den 1960er Jahren zeigen, dass Vollzeitstudierende ursprünglich etwa 24 Stunden pro Woche dem Lernen widmeten. Aktuelle Analysen jedoch weisen auf einen drastischen Rückgang hin, mit Zahlen zwischen 12 und 15 Stunden pro Woche, die Studierenden tatsächlich für akademische Tätigkeiten aufwenden. Dabei ist bemerkenswert, dass sich diese Tendenz bei allen demografischen Gruppen, Studiengängen und Hochschultypen zeigt. Bemerkenswert ist ebenso, dass die geringere Studienzeit nicht durch eine Zunahme bezahlter Erwerbstätigkeit erklärbar ist.
Tatsächlich arbeiten heute weniger Vollzeitstudierende als noch vor dreißig Jahren. Stattdessen hat sich ihre Zeitverteilung auf andere Lebensbereiche verlagert. So verbringen viele Studierende einen erheblichen Anteil ihres Tages mit Freizeitaktivitäten wie Entspannung, sozialer Interaktion und persönlicher Entwicklung abseits des Unterrichts. Zudem nimmt die Teilnahme an campusbezogenen außerunterrichtlichen Aktivitäten, etwa Clubs oder sozialen Netzwerken, sowie Arbeiten in Nebenjobs einen bedeutenden Platz ein. Besonders an bestimmten Elite-Universitäten ist der Fokus mancher Studenten auf Projekte außerhalb des klassischen Studiums bemerkbar – etwa das Engagement bei Start-ups oder professionelle Vereinsarbeit, die den Studienalltag massiv beanspruchen und das Lernen oft in den Hintergrund drängen.
Diese Verschiebung hat jedoch nicht nur Auswirkungen auf die individuelle akademische Leistung, sondern auch auf die Qualität und Tiefe des Lernens an den Hochschulen. Zahlreiche Forscher bestätigen den engen Zusammenhang zwischen der Zeit, die Studierende tatsächlich mit Lernen verbringen, und ihrem Studienerfolg. Somit führt die reduzierte Lernzeit nicht nur zu schlechteren Lernergebnissen, sondern auch zu Defiziten in grundlegenden Kompetenzen und der Entwicklung nachhaltiger Arbeitsgewohnheiten. Rückmeldungen von Lehrkräften unterstreichen dieses Problem: Viele berichten, dass Studierende häufig Schwierigkeiten haben, den Unterrichtsinhalten zu folgen, Klassengespräche zu führen oder grundlegende Lesestrategien zu beherrschen. Die Bereitschaft, Hausaufgaben zu erledigen, ist vielerorts niedrig.
Gleichzeitig erscheint der Lernaufwand vielen Studenten nicht nur überfordernd, sondern auch sinnlos oder unangemessen. Diese Situation ist auch Ausdruck einer sich wandelnden akademischen Kultur, in der die Erwartungen an die Studierenden immer weiter gesunken sind. Schon vor der Corona-Pandemie zeichnete sich ab, dass Lehrende im Umgang mit Studierenden oft dazu übergingen, Anforderungen zu reduzieren, um den ‚Ansprüchen‘ der Studierenden gerecht zu werden. Die Pandemie hat diesen Trend verstärkt, da Flexibilisierungen bei Abgabeterminen, Notenvergaben und Teilnahmebedingungen zunehmend zur Norm wurden. Dies führte vielfach zu einer Verfestigung eines Mindsets, in dem Leistungserwartungen als überhöht oder gar unzumutbar wahrgenommen werden.
Parallel zu den gesunkenen Arbeitsansprüchen hat auch die Notengebung eine paradoxe Entwicklung genommen. Trotz geringerer Studierzeiten und verlangsamtem Lerntempo steigen die durchschnittlichen Noten kontinuierlich an. Die Inflationsrate bei Noten ist sowohl an führenden Eliteuniversitäten als auch an öffentlichen und privaten Hochschulen alarmierend hoch. Mehr als drei Viertel der Noten sind inzwischen A-Minus oder besser. Dies führt zu einer Verwässerung der Aussagekraft von Noten und wirkt der Vermittlung echter akademischer Exzellenz entgegen.
Der Grund dafür liegt u.a. in einem als kollektiv wahrgenommenen Dilemma: Professorinnen und Professoren, die harsche Anforderungen stellen oder harte Noten vergeben, sehen sich oft einer breiten Gegenwehr von Studierenden ausgesetzt und riskieren negative Evaluationen oder sinkende Kursanmeldungen. Ein weiterer Aspekt, der diese Entwicklung verstärkt, ist die Rolle der studentischen Bewertungen von Lehrenden. Da diese Feedbacks erheblichen Einfluss auf Karriereentscheidungen von Hochschullehrern haben können, wird oft versucht, auf Studierendenwünsche nach geringerem Lernaufwand und leichteren Anforderungen einzugehen.
Dies führt zu einem Teufelskreis, in dem niedrige Anforderungen erwartet und eingefordert werden, was wiederum zu weiterem Abbau akademischer Standards führt. Die Konsequenzen dieser Entwicklungen für den Wert eines Hochschulabschlusses sind weitreichend. Studierende verlieren die Gelegenheit, den mit einem Studium eigentlich verbundenen Erwerb von Wissen, Analysefähigkeiten und Arbeitsdisziplin zu erlangen. Dies wirkt sich langfristig auf ihre Berufschancen, persönliche Entwicklung und gesellschaftliche Teilhabe aus. Auch die Hochschulen selbst sehen sich zunehmend in einer Legitimationskrise, denn die Frage nach der Qualität ihrer Bildungsangebote wird lauter und kritischer.
Vor diesem Hintergrund wächst die Forderung nach einer grundlegenden „Kulturwende“ an Hochschulen. Hochschulträger und Gremien sollten klare Leitlinien und verbindliche Erwartungen hinsichtlich der Studienleistungen setzen. Die vorhandenen Regelungen zur Studienarbeitszeit, wie sie beispielsweise im Rahmen der Vergabe von ECTS-Credits gelten, verlangen bereits, dass Studierende pro belegtem Kurs mindestens eine bestimmte Anzahl an Stunden für Unterricht und selbstständiges Arbeiten investieren sollen. Diese Mindestanforderungen müssen ernst genommen und konsequent umgesetzt werden, um der Degradierung akademischer Standards entgegenzuwirken. Eine zentrale Herausforderung ist dabei, die Verantwortung von den einzelnen Lehrkräften auf eine kollektive Ebene zu heben.
Solange einzelne Professoren riskieren, ihre Kurse zu verlieren oder schlechte Bewertungen zu erhalten, wenn sie die Erwartungshaltung erhöhen, wird sich wenig ändern. Deshalb wird empfohlen, dass Hochschulleitungen und Hochschulräte klare Vorgaben machen und das durch defizitäre kurzfristige Bewertungen unabhängige Qualitätskontrolle etablieren. Einheitliche Standards bei Arbeitsaufwand, Bewertungskriterien und Notenvergabe könnten hierbei eine zentrale Rolle spielen. Gleichzeitig sollte die Vermittlung von akademischer Disziplin und Arbeitskultur ein wichtiger Fokus werden. Studierende benötigen Unterstützung beim Zeitmanagement, der Entwicklung methodischer Kompetenzen und der Motivation.
Professoren sollten ermutigt und unterstützt werden, höhere Anforderungen zu stellen, ohne Angst vor negativen Konsequenzen haben zu müssen. Auch die Anerkennung von Lehrleistungen bei Personalentscheidungen, Promotionen und Beförderungen sollte ausgeweitet werden, um den Stellenwert von Hochschullehre zu erhöhen. Darüber hinaus sollten Hochschulen Transparenz über das tatsächliche Engagement der Studierenden herstellen. Regelmäßige Erhebungen zur Arbeitszeit, zum Umfang der Lektüre und zu anderen Studienaktivitäten können Schwachstellen sichtbar machen und helfen, gezielte Maßnahmen zu entwickeln. Externe Benchmarks und Vergleiche mit anderen Hochschulen können zudem die Motivation für Veränderung steigern.
Nicht außer Acht gelassen werden darf der Einfluss des vorangehenden Bildungssystems. Die mangelnde Vorbereitung vieler Studierender auf akademische Anforderungen in der Schule trägt erheblich zu den Herausforderungen des Hochschulalltags bei. Eine verstärkte Kooperation zwischen K-12-Bildungssystem und Hochschulen könnte langfristig die Grundlage für eine verbesserte Studierfähigkeit legen. Abschließend lässt sich feststellen, dass die Zeit, die heutige Studierende tatsächlich mit Lernen verbringen, vielfach nicht den Anforderungen eines Hochschulstudiums entspricht. Stattdessen dominieren Freizeit und andere außerschulische Aktivitäten den Alltag.
Dies hat weitreichende Folgen für die Qualität der Hochschulausbildung und den Wert akademischer Abschlüsse. Um dem entgegenzuwirken, sind klare Erwartungen, konsequente Standards und eine Kultur des ernsthaften Lernens erforderlich, die sowohl von Hochschulleitungen als auch von Lehrkräften und Studierenden mitgetragen wird. Eine solchen kulturellen Neustart zu initiieren ist eine der größten Herausforderungen für die Hochschulen und ist entscheidend für die Zukunftsfähigkeit des Bildungssystems insgesamt.