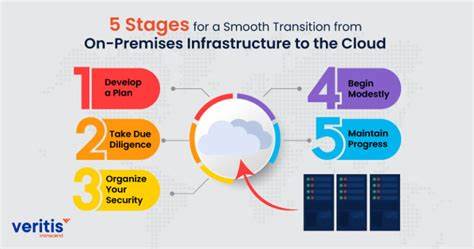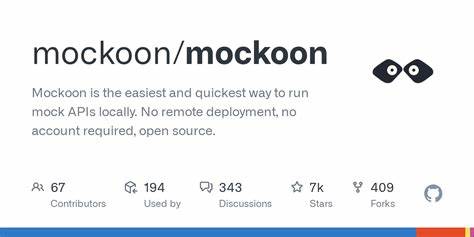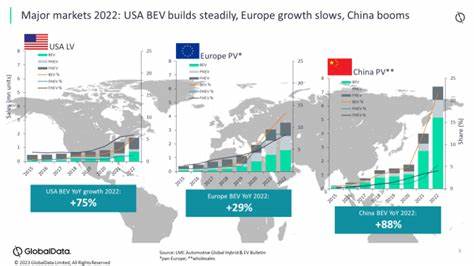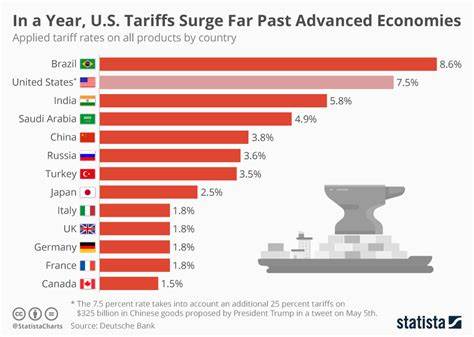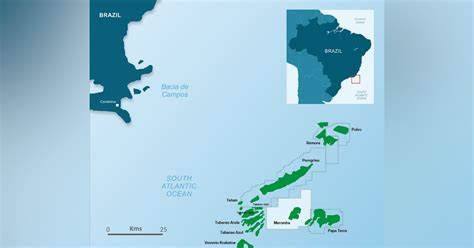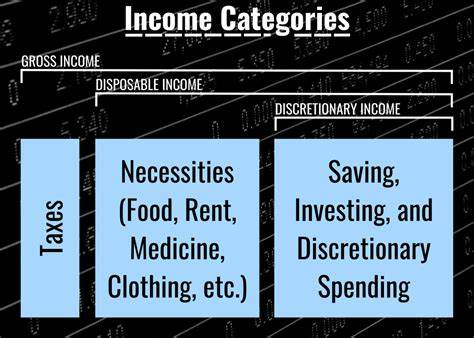Die rasante Entwicklung von Cloud-Technologien hat die Art und Weise, wie Unternehmen Anwendungen entwickeln, bereitstellen und skalieren, revolutioniert. Serverless-Architekturen haben hierbei maßgeblich dazu beigetragen, komplexe IT-Systeme effizient und kostensparend zu gestalten. Doch trotz der Vorteile der Cloud-basierenden Infrastruktur gibt es zunehmend Szenarien, in denen Unternehmen ihre Lösungen wieder vom Cloud-Betrieb in eine lokale Umgebung, das sogenannte On-Premise, verlagern möchten. Gründe hierfür reichen von Datenschutzanforderungen über die Notwendigkeit einer vollständigen Offline-Funktion bis hin zur erhöhten Kontrolle und Anpassbarkeit der IT-Umgebung. Die Migration serverloser Lösungen von der Cloud zum On-Premise-Setup ist jedoch mit einer Vielzahl technischer und organisatorischer Herausforderungen verbunden.
Ein tiefgehendes Verständnis dieser Schwierigkeit kann Unternehmen helfen, den Schritt erfolgreich zu meistern und die gewohnte Funktionalität sowie Skalierbarkeit beizubehalten. Bei der Migration einer komplexen IoT-Plattform, die ursprünglich vollumfänglich auf AWS serverless ausgelegt war, konnten wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden, die als Best Practices für ähnliche Vorhaben dienen. Zunächst erfordert der Übergang vom Cloud-Anbieter zu einer eigenen Infrastruktur eine gründliche Analyse aller Architekturkomponenten. In der Cloud agieren Serverless Funktionen oft in einem elastischen, hochgradig automatisierten Ökosystem, das sich dynamisch an die Last anpasst und Dienste wie Message Queuing, Datenbanken, Authentication oder Monitoring nahtlos integriert. Lokal müssen diese Funktionen ersetzt oder nachgebildet werden, was sorgfältige Planung benötigt.
Für die Kernkomponenten der Infrastruktur bietet sich in der On-Premise-Umgebung die Containerisierung mittels Docker an, da sie die Unterstützung von Microservices, leichtgewichtige Isolation und eine reproduzierbare Umgebung ermöglicht. Das Aufsetzen erfolgt idealerweise auf zwei Hauptservern: einem Application-Server zur Verwaltung aller Applikationsdienste und einem spezialisierten Datenbank-Server, optimiert für leistungsstarke PostgreSQL-Abfragen. Die Komplexität der verteilten IoT-Datenströme erfordert zudem einen robusten Nachrichtenbroker für effiziente Gerätekommunikation. Open-Source-Lösungen wie Mosquitto für MQTT haben sich für lokale Deployments bewährt, bieten Authentifizierungsmechanismen und erlauben granularen Zugriffsschutz. Für die verteilte Verarbeitung und asynchrone Nachrichtenvermittlung findet RabbitMQ als AMQP-konformer Broker Einsatz, der in Verbindung mit einem sogenannten Bridge-Service eine nahtlose Protokollübersetzung und intelligente Nachrichtenverteilung ermöglicht.
Die serverlosen AWS Lambda-Funktionen, die typischerweise ereignisgesteuert und hoch skalierbar ausgeführt werden, müssen lokal neu implementiert werden. Hierbei wurde die Funktionalität in Node.js-Anwendungen übertragen, wobei statt einer Lambda-Invoke-Umgebung lokale Funktionaufrufe genutzt wurden. Dies eröffnete die Möglichkeit, die Codebasis weitestgehend zu erhalten,trieb jedoch eine Herausforderung hinsichtlich der Performance mit sich. Ursprünglich wurden Nachrichten seriell verarbeitet, was die Prozessleistung limitierte.
Um die parallele Ausführung zu ermöglichen und serverseitige Ressourcen besser auszuschöpfen, wurde auf ein Multi-Threading-Modell mit dedizierten Warteschlangen umgestellt. Die Verteilung basiert intelligent auf einem Hashing-Verfahren der Geräte-MAC-Adressen, wodurch erreicht wurde, dass Nachrichten eines Gerätes dennoch sequentiell verarbeitet werden, jedoch Last auf mehrere Worker effizient verteilt wird. Auch im Backend fand eine grundlegende Umstrukturierung statt. Die Vielzahl einzelner API-Lambdas wurde zu einem Node.js-Monolithen zusammengeführt, der mit Express betrieben wird.
Damit wurde die Wartbarkeit erhöht und gleichzeitig die ursprüngliche Serverless-Logik erhalten. Ein entscheidender Aspekt bei der Migration war die Simulation der AWS Lambda-Ereignisobjekte über Middleware, sodass vorhandene Funktionen mit minimalen Änderungen nutzbar blieben. Die Integration von OpenAPI/Swagger erleichterte die automatisierte Erstellung der Routen und reduzierte manuellen Aufwand, was Entwicklungszyklen signifikant verkürzte. Ein besonders sensibler Bereich ist die Authentifizierung und Autorisierung. AWS Cognito wurde durch einen selbstentwickelten JWT-basierten Authentifizierungsdienst ersetzt, der sowohl Sicherheit als auch die umfangreichen Berechtigungsprüfungen abbildet.
Dieses Eigenentwicklungen bot volle Kontrolle über die Nutzer- und Zugriffsdaten während gleichzeitig die Benutzererfahrung erhalten blieb. Das Frontend, basierend auf React und ursprünglich über CloudFront ausgeliefert, wurde mit minimalen Anpassungen innerhalb einer Nginx-basierten Hostinglösung bereitgestellt. SSL-Zertifikate wurden manuell eingebunden, um das HTTPS-Protokoll sicherzustellen und somit den Datenverkehr gemäß heutigen Sicherheitsanforderungen zu verschlüsseln. Neben der technischen Migration war auch der Aufbau eines umfassenden Monitoring- und Logging-Systems essenziell. Während in der Cloud Dienste wie AWS CloudWatch zentralisiert Logmanagement, Metriken und Alarme bereitstellen, mussten lokale Open-Source-Werkzeuge dies kompensieren.
Logrotate gewährleistet eine ordentliche Protokollrotation zur Vermeidung von Speicherengpässen. Prometheus stellt die Echtzeit-Sammlung von Systemmetriken sicher und erlaubt die Konfiguration individuell an die Umgebung angepasster Alarmregeln. So können kritische Statusänderungen im System frühzeitig erkannt und reagiert werden. Zusammenfassend zeigt sich, dass die Migration serverloser Architekturen von der Cloud hin zum On-Premise-Betrieb eine sorgfältige Planung, fundierte technische Umsetzung und ein ausgeprägtes Monitoring erfordert. Der Verzicht auf die Elastizität der Cloud ist ein bedeutender Einschnitt, der durch intelligente Architekturlösungen und effiziente Ressourcennutzung kompensiert werden muss.
Die Vorteile liegen nicht nur in einer höheren Kontrolle und individuellen Anpassbarkeit, sondern auch im Entfall von Cloud-spezifischen Latenzen wie Cold Starts. Das gestiegene Maß an Verantwortung sollte nicht unterschätzt werden, jedoch bietet das neue Setup für Unternehmen, die absolute Datensouveränität, Offline-Fähigkeit und individuelle Prozesskontrolle benötigen, den wichtigen Handlungsspielraum. Die gewonnenen Erfahrungen aus realen Anwendungsfällen, bei denen eine umfangreiche IoT-Serverless-Plattform erfolgreich migriert wurde, zeigen, dass es möglich ist, höchste Performance und Funktionsumfang auch in einer lokalen Umgebung zu erreichen. Durch den Einsatz von Docker, zuverlässigen Message Brokern, effizienten Node.js-Implementierungen sowie einem maßgeschneiderten Authentifizierungsmodell wird eine robuste und skalierbare Alternative zur Cloud geschaffen.
Für Unternehmen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen, bieten diese Einblicke eine wertvolle Orientierung und praktischen Bezug, um den Weg zur eigenen On-Premise Serverless-Architektur zu beschreiten.