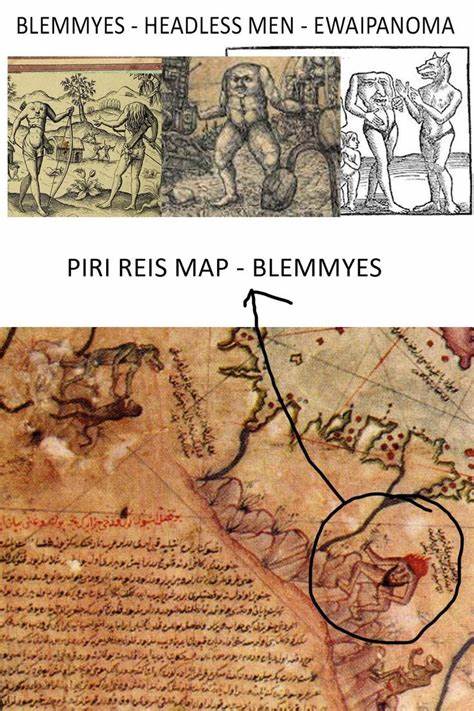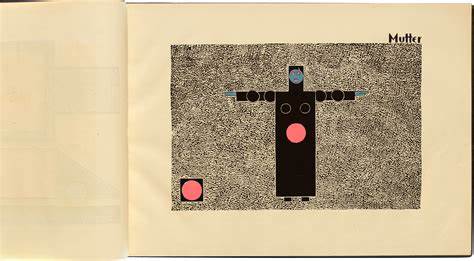Google ist eines der mächtigsten Unternehmen der Welt und hält seit Jahren eine dominierende Stellung im Internetsuchmarkt und darüber hinaus. Trotz zahlreicher Kartellrechtsverfahren, die gegen das Unternehmen angestrengt wurden – von der Trump- bis zur Biden-Administration – besteht Google weiterhin in seiner heutigen Form, ohne nennenswerte Zerschlagung oder grundlegende Einschränkungen. Die Frage, warum Google nach all dem juristischen Widerstand und mehreren verlorenen Verfahren weiterhin so stark und unversehrt ist, führt uns auf eine Reise durch die Geschichte des Wettbewerbsrechts, die Besonderheiten der digitalen Wirtschaft und die juristischen und politischen Dynamiken, die hier eine Rolle spielen. Historischer Kontext zu Kartellrecht und Machtkonzentration Die amerikanische Rechtstradition des Wettbewerbsrechts hat eine lange Geschichte darin, monopolistische Unternehmen zu zerschlagen, um den freien Wettbewerb zu schützen. Besonders prägnantes Beispiel ist der Fall Standard Oil von 1911, bei dem der Oberste Gerichtshof die Zerschlagung des Ölmonopols in zahlreiche kleinere Unternehmen anordnete, um dessen Marktherrschaft zu beenden.
Das Ziel solcher Maßnahmen war nicht nur die Verhinderung verantwortungslosen Marktmachtmissbrauchs, sondern auch die Wiederherstellung eines dynamischen und fairen Marktes, in dem Innovationen und Verbraucherwohl im Mittelpunkt stehen. Auch in der Mitte des 20. Jahrhunderts gab es klare Präzedenzfälle, die bestätigten, dass Gerichte befugt sind, harte und umfassende Maßnahmen zu ergreifen, um monopolistische Praktiken zu beenden. So stellte etwa der Fall United Shoe im Jahr 1968 klar, dass bei einem festgestellten Verstoß gegen Wettbewerbsrecht das Gericht verpflichtet ist, die monopolistische Struktur zu zerschlagen und den durch den Rechtsverstoß erlangten Nutzen dem Täter zu entziehen. Auch weitreichende Maßnahmen wie die Regulierung weit darüber hinausgehender Praktiken wurden als rechtmäßig anerkannt, wie im Fall International Salt zu sehen ist, wo das Gericht vorschrieb, dass das fragliche Unternehmen seine Maschinen auch Nicht-Kunden zu fairen Bedingungen bereitstellen müsse, um weitergehende Marktbeherrschung durch „verkettete“ Praktiken zu verhindern.
Warum scheinen diese Traditionen heute nicht mehr zu gelten? Im Gegensatz zur Vergangenheit beobachten wir heute eine erstaunliche Zurückhaltung bei der Zerschlagung von Großkonzernen wie Google. Trotz klarer Urteile gegen die Marktdominanz und mehreren verlorenen Kartellrechtsverfahren steht das Unternehmen weiterhin weitgehend ungetrennt da, was viele Beobachter irritiert. Diese Entwicklung geht zurück auf mehrere Faktoren, die vor allem in den rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Verschiebungen der letzten Jahrzehnte wurzeln. Ein wesentlicher Einflussfaktor ist das Urteil im Fall Microsoft von 2001, das in vielerlei Hinsicht wegweisend für alle folgenden Tech-Kartellprozesse war. Dort wurde zwar eine marktbeherrschende Stellung festgestellt, doch die von einem untergeordneten Gericht vorgeschlagene Zerschlagung des Unternehmens wurde vom Berufungsgericht aufgehoben.
Das Urteil ging weit über die konkrete Situation hinaus und stellte die Eignung struktureller Zerschlagungsmaßnahmen grundsätzlich infrage. Seitdem gilt in der Praxis eine gewisse Zurückhaltung gegenüber radikalen Eingriffen in große Konzerne, besonders in dynamischen Technologiebranchen. Die Argumentation des Gerichts basierte auf der Annahme, dass in technologisch dynamischen Märkten Marktmacht oft temporär sei, da Innovationen bestehende Strukturen schnell herausfordern können. Diese These, verwoben mit den Ideen der sogenannten Chicagoer Schule der Ökonomie, führte zu einem Paradigmenwechsel, bei dem nicht mehr die Zerschlagung von Monopolen als Standardmaßnahme galt, sondern eher eine vorsichtige Abwägung und Zurückhaltung gegenüber Eingriffen. Verfahren dieser Art werden seitdem oft schwieriger, weil das Gericht nachweisen will, dass eine bestimmte Verhaltensweise ursächlich für das Entstehen und den Erhalt der Marktmacht ist – ein Anspruch, der in der digitalen Welt mit ihren komplexen Netzwerkeffekten und schnellen Innovationszyklen schwer zu erfüllen ist.
Die Besonderheiten der digitalen Wirtschaft: Warum regulieren schwerfällt Digitale Märkte sind durch eine besondere Dynamik gekennzeichnet. Anders als in traditionellen Industrien wie der Ölraffination, wo materielle Infrastruktur schwer kopierbar ist, beruht die Dominanz von Google vor allem auf Daten, Algorithmen und Netzwerkeffekten. Dabei ist eine wesentliche Besonderheit: Im Prinzip ließe sich eine Suchmaschine technisch duplizieren oder sogar verbessern, und Rivalen könnten versuchen, Marktanteile durch Softwareinnovationen zurückzugewinnen. Dennoch erschwert Googles herausragende Position im Ökosystem, etwa durch exklusive Vereinbarungen mit Hardwareherstellern wie Apple oder Browserherstellern wie Mozilla, den Markteintritt von Wettbewerbern erheblich. Google kontrolliert Schlüssel-Ressourcen und verteilt den Zugang zum Suchmarkt über seine eigene Plattform Chrome sowie das Betriebssystem Android.
Diese „Vermarktung“ der Standards und Zugriffswege ist ein Aspekt der Marktdominanz, der sich nur schwer juristisch durchbrechen lässt, selbst wenn die Technologie grundsätzlich offen oder kopierbar wäre. Gerade hier liegt die Herausforderung für Wettbewerbsbehörden: Es geht nicht nur um reine Produktqualität, sondern um die Kontrolle des Zugangs und die Vorherrschaft durch geschickte geschäftliche Vereinbarungen. Die Frage, ob durch rechtliche Maßnahmen die Barrieren für neue Anbieter tatsächlich weggefallen werden, ist komplex und mit Risiken verbunden. Die vorgeschlagenen Abhilfemaßnahmen gegen Google: Warum sie weniger radikal sind als erwartet Angesichts der Rechtsprechung und der Dynamiken der Branche setzte die US-Justizbehörde (DOJ) bei der aktuellen Klage gegen Google auf eine Reihe von spezifischen Beschränkungen statt auf eine radikale Zerschlagung des Unternehmens. Vorschläge wie das Entfernen der automatischen Suchmaschineneinstellung (Default-Setting) auf Browsern, das Ende von Zahlungen für bevorzugte Platzierungen, die Abspaltung des Chrome-Browsers oder stärkere Regulierungen des Betriebssystems Android sind durchdachte Maßnahmen, die den Wettbewerb öffnen sollen, ohne Google direkt zu zerschlagen.
Diese Form der behutsamen Intervention soll die durch Google geschaffenen Markthindernisse abbauen und Rivalen den Zugang zu Daten und Nutzungsmöglichkeiten erleichtern. Allerdings gingen sie nicht so weit, Google vollständig zu spalten oder den eigenen Suchalgorithmus technisch zu kopieren und an unabhängige Wettbewerber weiterzugeben, was für viele Juristen eine mögliche Lösung zur wirklichen Beendigung der Marktdominanz gewesen wäre. Gerade der Umstand, dass die Behörden selbst nicht auf eine vollständige Auflösung drängen, zeigt die rechtlich-politische Vorsicht, die heute vorherrscht. Teilweise liegt das daran, dass Richter wie Amit Mehta die Komplexität des Feldes und die Gefahr einer juristischen Aufhebung ihres Urteils durch höhere Instanzen fürchten. Ein weiteres Argument ist, dass radikale Maßnahmen in der Konsequenz auch schwer kalkulierbare wirtschaftliche Schäden anrichten könnten.
Die menschliche Dimension: Generationen von Kartellexperten und ihre prägende Wirkung Ein weiterer Aspekt ist, dass gerade die erfahrenen Kartellrechtspraktiker in Washington ihre Reputation und Karriere maßgeblich mit dem Microsoft-Fall aufgebaut haben. Diese Altvorderen des Antitrust wird oft etwas Skepsis gegenüber radikalen Interventionen in der heutigen Technologiebranche nachgesagt, was sich darin widerspiegelt, dass viele rechtliche Strategien hier stark an das damalige Vorgehen anknüpfen. Somit prägen individuelle Karrieren und historische Präzedenzfälle bis heute nachhaltig die Strategie der Wettbewerbsbehörden und Gerichte – und das trotz der fundamentalen Unterschiede zwischen der Software- und Internetindustrie und der „Old-Economy“-Industrie der 20. Jahrhunderts. Die ökonomische Realität: Big Tech frisst die Wirtschaft auf Aus ökonomischer Sicht ist die Dominanz von Google Teil eines größeren Trends, in dem wenige Technologiekonzerne einen großen Teil der Marktanteile und Gewinne der globalen Wirtschaft beanspruchen.
Professionelle Analysten, wie etwa Michael Cembalest von JP Morgan, sprechen davon, dass gewisse Margen in der Wirtschaft auf ein paar große Unternehmen – inklusive Google und Meta – übergehen, während andere Marktteilnehmer schrumpfen oder stagnieren. Das Wachstum wirklich großer Konzerne ist ungewöhnlich, denn wirtschaftliche Theorie sagt eigentlich, dass es schwieriger werden sollte, je größer ein Unternehmen wird. Bei Google, Meta, Amazon und Microsoft scheint das Gegenteil der Fall zu sein: Sie wachsen weiter zweistellig, sicherten sich mit Übernahmen weitere Schlüsselbereiche und bauen ihre Marktmacht kontinuierlich aus. Diese Entwicklung führt zu spürbaren Wettbewerbsverzerrungen auf vielen Ebenen, etwa bei der Kundengewinnung, wo kleine und mittlere Unternehmen bei steigenden Werbekosten auf Social-Media-Plattformen kaum mehr Fuß fassen können. Daten, Algorithmen und Netzwerkeffekte bauen Barrieren auf, die für Neuankömmlinge oft kaum zu überwinden sind.
Die Zukunft des Kartellrechts im digitalen Zeitalter Obwohl die aktuellen Maßnahmen gegen Unternehmen wie Google wenig radikal erscheinen, sind sie Teil eines sich wandelnden Klimas im Kartellrecht. In den letzten Jahren haben viele Wettbewerbshüter mehr Mut gefunden, aggressive Verfahren einzuleiten. Der Erfolg einiger dieser Verfahren haben die Diskussion über eine konsequentere Regulierung und ggf. sogar über Zerschlagungen neu entfacht. Der juristische Spielraum für gerichtliche Eingriffe ist nicht so eingeschränkt, wie man meinen könnte – strenge und kreativ gestaltete Maßnahmen sind möglich, wenn der politische und gesellschaftliche Wille vorhanden ist.
In einer Zeit, in der die Dominanz großer Tech-Konzerne zunehmend kritisch hinterfragt wird, wächst der Druck auf Gerichte und Behörden zu handeln. Gleichzeitig dürfte es aber auch weiterhin ein langwieriger Prozess bleiben, die alten Traditionen aus der Zeit von Standard Oil oder United Shoe mit der hochkomplexen digitalen Realität in Einklang zu bringen. Die Rechtsprechung der letzten Jahrzehnte, die durch konservativere und ökonomisch orientierte Gedanken geprägt ist, muss sich auf eine neue Ära einstellen, in der Marktmacht nicht nur eine Frage physischen Zugangs, sondern vor allem von Datenhoheit und Informationskontrolle ist. Fazit Google besteht noch, weil sich die Entwicklung des Kartellrechts in den USA in den letzten Jahrzehnten von radikalen Zerschlagungen hin zu vorsichtigen und wirtschaftlich ausgerichteten Maßnahmen verändert hat. Digitale Märkte mit ihren komplexen Netzwerkeffekten stellen Gerichte und Behörden vor beispiellose Herausforderungen, die alten Werkzeuge aus einer Zeit der Rohstoffmonopole erscheinen dabei oft unpassend.