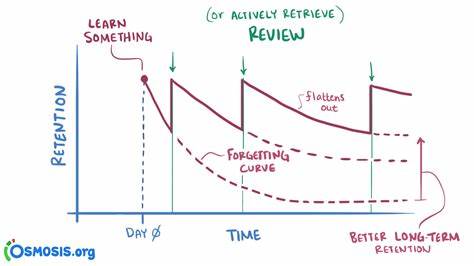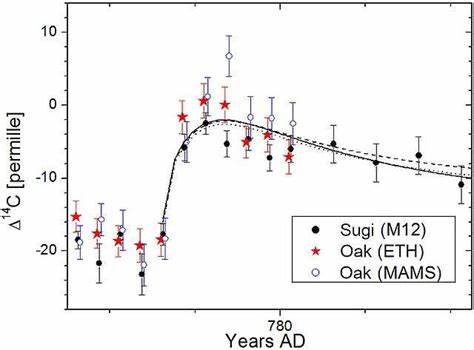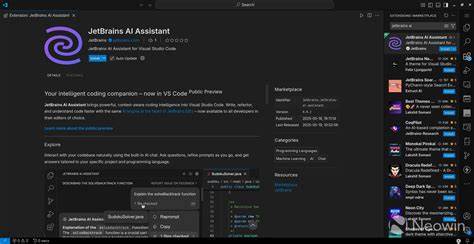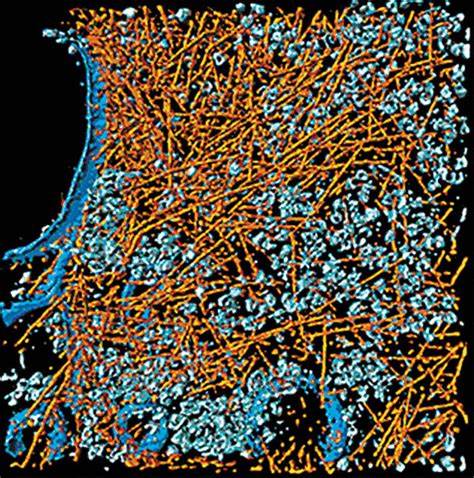Sprache ist ein zentraler Bestandteil menschlicher Gesellschaften und prägt Kommunikation, Kultur und Identität. In einer globalisierten Welt, in der wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Austausch über Landesgrenzen hinweg immer intensiver wird, bekommt das Verständnis von Sprachvernetzung eine besondere Bedeutung. Genau an diesem Schnittpunkt setzt das Domestic and International Common Language (DICL) Dataset an, das einen umfassenden Datensatz vorstellt, der Sprachverbindungen innerhalb und zwischen Ländern auf bislang unerreichter Detailliertheit misst. Das DICL Dataset ist eine von Experten entwickelte globale Sammlung linguistischer Daten, die Informationen zu über 6.600 Sprachen in 242 Ländern und Gebieten zusammenfasst.
Es basiert auf dem Ethnologue-Datenbestand, der als eine der umfassendsten Quellen für sprachliche Daten weltweit gilt. Die Besonderheit dieses Datensatzes liegt darin, dass er nicht nur internationale Sprachverbindungen zwischen Ländern erfasst, sondern auch sprachliche Vielfalt und Verbindungen innerhalb der einzelnen Länder dokumentiert. Die linguistischen Indizes im DICL Dataset bieten differenzierte Maße zur quantitativen Erfassung von Sprachverbindungen. Dazu zählen beispielsweise die gemeinsamen offiziellen Sprachen, gemeinsame Mutter- oder Zweitsprachen sowie verschiedene Formen sprachlicher Nähe basierend auf der evolutionären Entwicklung von Sprachen. Die insgesamt elf Indizes gliedern sich in drei Hauptkategorien: Offizielle Sprachen, gemeinsame gesprochene Sprachen und sprachliche Nähe.
Unter den offiziellen Sprachen unterscheidet der Datensatz zwischen einer liberaleren Definition, die auch regionale und lokale offizielle Sprachen berücksichtigt, und einer restriktiveren Definition, die nur national anerkannte Amtssprachen einbezieht. Diese Differenzierung ist von großer Bedeutung, da offizielle Sprachen oft die Sprachen sind, die in Verwaltung, Bildung und Wirtschaft vorherrschen. Gemeinsame Sprachen werden in der Muttersprache sowie als erworbene Sprachen behandelt. So kann das DICL Dataset abbilden, inwieweit beispielsweise Englisch oder Mandarin durch zweitsprachliche Sprecher in verschiedenen Ländern verbreitet sind. Eine Kombination dieser beiden Kategorien bildet den sogenannten „Common Spoken Language“-Index, der die gesamte sprachliche Verknüpfung abbildet.
Eine der innovativsten Komponenten des DICL Datasets sind die Indizes der sprachlichen Nähe. Diese gehen über das bloße Teilen einer Sprache hinaus und betrachten, wie eng zwei verschiedene Sprachen linguistisch miteinander verwandt sind. Hierzu nutzt das Dataset die sprachlichen Stammbaumanalysen des Ethnologue und berücksichtigt, wie viele gemeinsame linguistische Äste zwei Sprachen haben und wie weit sie sich voneinander entfernt entwickelt haben. So kann beispielsweise die Nähe zwischen Portugiesisch und Spanisch gemessen werden, obwohl sie unterschiedliche Sprachen sind, durch ihre gemeinsame Wurzel und Ähnlichkeit. Die sprachlichen Nähe-Indizes werden für Muttersprachler, Zweitsprachler und alle Sprecher zusammen berechnet, wodurch vielfältige Anwendungen möglich sind.
Ein weiterer Satz von Indizes, die sogenannten Branch Proximity Indices, bieten eine alternative Methode zur Messung sprachlicher Nähe, die unabhängig von der Länge der Sprachstämme funktioniert. Die Stärke und Verbreitung von Sprachverbindungen variieren stark zwischen Ländern. Staaten wie Indien, die viele offiziell anerkannte Sprachen besitzen oder mehrsprachige Bevölkerungen aufweisen, zeigen hohe Werte bei offiziellen Sprachindizes. Länder mit starken kolonialen Verbindungen präsentieren häufig ausgeprägte bilinguale oder multilinguale Strukturen, die die globalen Kommunikationsströme prägen. Gleichzeitig finden sich isolierte sprachliche Gemeinschaften, die kaum oder keine Verbindungen zu anderen Ländern aufweisen.
In praktischer Hinsicht wird das DICL Dataset bereits vielfältig eingesetzt. Die Wirtschaftsforschung nutzt es, um den Einfluss sprachlicher Verwandtschaft auf den internationalen Handel zu analysieren. Sprachliche Barrieren oder gemeinsame Kommunikationssprachen beeinflussen den Austausch von Gütern und Dienstleistungen, so zeigen Studien, dass Länder mit sprachlichen Gemeinsamkeiten tendenziell intensiveren Handel betreiben. Auch in der Migrationsforschung spielen sprachliche Bindungen eine relevante Rolle, da Sprachähnlichkeiten kulturelle Nähe und Integrationsmöglichkeiten erhöhen können. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die linguistische Diversität innerhalb von Ländern, die durch die DICL-Datensätze quantitativ abgebildet wird.
Länder mit hoher Sprachenvielfalt wie Papua-Neuguinea oder Kamerun werden somit besser verstanden. Dies ist insbesondere im Hinblick auf Bildungspolitik, gesellschaftlichen Zusammenhalt und Minderheitenschutz von Bedeutung. Die Datengrundlage des DICL Datasets baut ausschließlich auf veröffentlichten und aggregierten Ethnologue-Daten auf. Es wurden keine zusätzlichen Mikrodatenerhebungen vorgenommen. Das ermöglicht Konsistenz, macht die Daten jedoch abhängig von der Qualität und Aktualität der Ethnologue-Informationen.
Dennoch vergleicht das Dataset sich gut mit älteren Datensammlungen und bietet in zahlreichen Fällen verbesserte und erweiterte Informationen. Technisch betrachtet liegt das DICL Dataset als CSV-Datei vor, die mit verbreiteten Statistikprogrammen einfach verarbeitet werden kann. Neben den linguistischen Indizes enthält der Datensatz Länderidentifikatoren, Länderkürzel und Namen, was die Kombination mit anderen statistischen Quellen und die Integration in multivariate Analysen erleichtert. Das Potenzial zur Erweiterung der Forschung ist enorm. Durch die Verfügbarkeit detaillierter Sprachverbindungen können Wissenschaftler aus den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Anthropologen, Politikwissenschaftler und Sprachforscher ihre Analysen mit präziseren und umfassenderen Variablen anreichern.
Der Einfluss von Sprache auf globale Beziehungen, Handel, Migration, kulturelle Integration und politische Stabilität kann so differenzierter untersucht werden. Das DICL Dataset repräsentiert einen wichtigen Fortschritt im Bereich der quantitativen Sprachforschung. Indem es Sprachverbindungen nicht nur als binäre Größe – gemeinsame Sprache ja oder nein – abbildet, sondern durch differenzierte Maße die Tiefe und Vielfalt der sprachlichen Verflechtungen darstellt, bringt es neue Erkenntnisse und Forschungsmöglichkeiten. Zukünftig könnten weitere Datenquellen integriert oder durch Erhebungen verfeinert werden, um beispielsweise Veränderungen in der Sprachlandschaft im Zuge von Migration oder technologischen Entwicklungen abzubilden. Zudem eröffnen die Indizes Möglichkeiten, das Zusammenwirken von Sprache und anderen sozioökonomischen Faktoren noch präziser zu analysieren.